-
DNQP: Aufruf zur Bewerbung als wissenschaftliche Leitung der Expert*innenarbeitsgruppe zum Thema "Delir"
![]()
Die wissenschaftliche Leitung der Expert*innenarbeitsgruppe zeichnet verantwortlich für die Erstellung einer evidenzbasierten Literaturstudie und das wissenschaftliche Niveau von Expertenstandard und Kommentierungen unter Berücksichtigung von Praxisbedingungen. Wünschenswert ist die Zusicherung der Verfügbarkeit von zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen mit entsprechender Qualifikation für die Recherche und Bewertung der Literatur und Erstellung einer Literaturstudie nach anerkannten Verfahren. Entsprechende finanzielle Mittel hierfür werden durch das DNQP bereitgestellt. Die Position der wissenschaftlichen Leitung ist ehrenamtlich, anfallende Reise- und Übernachtungskosten werden erstattet.
In enger Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Team des DNQP entwickeln die wissenschaftliche Leitung und die Expert*innenarbeitsgruppe auf Basis einer Literaturstudie einen Entwurf des Expertenstandards, der auf einer Konsensus-Konferenz 2027 der Fachöffentlichkeit vorgestellt wird. Der Start der Entwicklung ist für den Sommer 2025 geplant. Detaillierte Hinweise zur Vorgehensweise finden sich im Papier zum methodischen Vorgehen zur Entwicklung, Einführung und Aktualisierung von Expertenstandards des DNQP (www.dnqp.de/methodisches-vorgehen).
Neben einer Darlegung der fachlichen Expertise werden die Bewerber*innen gebeten, eigene Interessen, Verbindungen zur Industrie oder Interessensverbänden offen zu legen, um die wissenschaftliche Unabhängigkeit des Expertenstandards garantieren zu können. Die Mitglieder einer neuen Expert*innenarbeitsgruppe werden in einem weiteren Bewerbungsverfahren gemeinsam mit der wissenschaftlichen Leitung ausgewählt. Hierzu erfolgt ein gesonderter Aufruf zur Bewerbung im März 2025.
Bewerbungen (gerne auch per E-Mail) werden bis zum 15. März 2025 an folgende Anschrift erbeten:
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP)
an der Hochschule OsnabrückWissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Büscher
Postfach 19 40, 49009 Osnabrück
E-Mail:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Internet: www.dnqp.de -
FH Kärnten unterstützt pflegende Angehörige durch innovative Workshopreihe
![]() Pflegende Angehörige leisten im Verborgenen Großes: Etwa eine Million Menschen in Österreich versorgen ihre Angehörigen zu Hause. Die FH Kärnten und das Rote Kreuz Kärnten unterstützen sie mit praxisnahen Workshops und digitalen Lernangeboten. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben das Rote Kreuz Kärnten und die FH Kärnten eine praxisorientierte Workshopreihe ins Leben gerufen. Durch gezielte Schulungen sollen sie mehr Zeit und Lebensqualität gewinnen und ihre Aufgaben leichter bewältigen können.
Pflegende Angehörige leisten im Verborgenen Großes: Etwa eine Million Menschen in Österreich versorgen ihre Angehörigen zu Hause. Die FH Kärnten und das Rote Kreuz Kärnten unterstützen sie mit praxisnahen Workshops und digitalen Lernangeboten. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben das Rote Kreuz Kärnten und die FH Kärnten eine praxisorientierte Workshopreihe ins Leben gerufen. Durch gezielte Schulungen sollen sie mehr Zeit und Lebensqualität gewinnen und ihre Aufgaben leichter bewältigen können.Wissen aus der FH für die Praxis: Workshops für den Pflegealltag
Die FH Kärnten vermittelt in der Workshopreihe wissenschaftlich fundiertes Wissen und nutzt innovative Lehrmethoden. Das VIDSONS-Projekt (Video Lessons) spielt dabei eine zentrale Rolle, indem es den Teilnehmenden eine flexible, multimediale Begleitung über die Präsenzworkshops hinaus bietet.
„Mit der Workshopreihe kann die FH Kärnten Wissen und Ressourcen, welche im Rahmen der Lehr- und Lernförderung an der FH Kärnten geschaffen wurden, auch an diese so wichtige Gruppe der Pflegenden Angehörigen weitergeben und so einen wichtigen Beitrag für die Versorgung von zu Pflegenden leisten“ sagt Martin Schusser, Leiter des Projekts.
Die Workshops decken relevante Themen des Pflegealltags ab, darunter:
- Transfertechniken: Sicheres Heben und Umlagern von Pflegebedürftigen
- Ergonomie: Tipps zur gesunden Körperhaltung für Pflegende
- Sturzprophylaxe: Strategien zur Vermeidung von Stürzen
- Hilfsmittelversorgung: Einsatz praktischer unterstützender Geräte
Die Termine der Workshops sind:
- 18.02.2025, 18:00 Uhr: Rotkreuz-Bezirksstelle Klagenfurt
- 19.02.2025, 18:00 Uhr: Rotkreuz-Bezirksstelle Villach
- 20.02.2025, 18:00 Uhr: Rotkreuz-Bezirksstelle Wolfsberg
Anmeldungen sind online unter https://shorturl.at/AwtAq bis jeweils 20:00 Uhr am Vortag möglich. Die Workshops finden nur bei mindestens 10 Anmeldungen statt.
VIDSONS: Lernen zu Hause - jederzeit und flexibel
Das Besondere an diesem Projekt ist die begleitende Nutzung der im Rahmen des VIDSONS-Projekts erstellten Lernvideos. Diese wurden von der FH Kärnten konzipiert und bieten den Teilnehmer:innen eine flexible Möglichkeit, das Gelernte zu Hause jederzeit zu vertiefen.
Die Videos sind über den offiziellen YouTube-Kanal „VIDSONS - Video Lessons“ abrufbar:
VIDSONS Playlist auf YouTubeUnterstützung, die ankommt
„Pflegende Angehörige sind oft schwer erreichbar, da sie vollständig in ihre Pflegeaufgaben eingebunden sind. Uns ist es daher wichtig, einen besonders niederschwelligen Zugang zu diesen Unterstützungsangeboten zu schaffen,“ betont Brigitte Pekastnig, 3. Rotkreuz-Vizepräsidentin und Referentin für Gesundheits- und Soziale Dienste.
Die Initiative der FH Kärnten und des Roten Kreuzes Kärnten zielt darauf ab, den Alltag pflegender Angehöriger zu erleichtern und auf die oft unsichtbaren Herausforderungen dieser Aufgabe aufmerksam zu machen. Das gemeinsame Ziel ist es, die häusliche Pflege sicherer, gesünder und einfacher zu gestalten.
Zur Pressemitteilung: https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20250205_OTS0079/fh-kaernten-unterstuetzt-pflegende-angehoerige-durch-innovative-workshopreihe-zentrale-rolle-des-vidsons-projekts
Foto: stock.adobe.com - maxbelchenko
-
ÖGKV fordert flächendeckende Verankerung von School Nurses in Österreich
![]() Der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) begrüßt die Ausweitung der School Nurses in Wien und fordert eine nachhaltige Implementierung dieser wichtigen Unterstützung im Schulalltag. Der ÖGKV hat sich lange für diese Maßnahme eingesetzt und sieht die aktuelle Entwicklung als wichtigen Erfolg für die Gesundheitsversorgung in Schulen
Der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) begrüßt die Ausweitung der School Nurses in Wien und fordert eine nachhaltige Implementierung dieser wichtigen Unterstützung im Schulalltag. Der ÖGKV hat sich lange für diese Maßnahme eingesetzt und sieht die aktuelle Entwicklung als wichtigen Erfolg für die Gesundheitsversorgung in SchulenSchool Nurses spielen eine essenzielle Rolle bei der gesundheitlichen und psychosozialen Betreuung von Schüler:innen und sollten nicht nur als befristetes Projekt bestehen. „Die Anwesenheit von School Nurses in Schulen ist ein wesentlicher Beitrag zur Gesundheitsförderung und Prävention. Sie sind erste Ansprechpersonen für gesundheitliche Anliegen und fördern Gesundheitskompetenz“, betont ÖGKV Präsidentin Elisabeth Potzmann.
Der ÖGKV fordert daher:
- Eine österreichweite Etablierung von School Nurses
- Sicherstellung der Finanzierung
„Die Aufstockung auf 40 School Nurses ist ein wichtiger Schritt, aber es muss sichergestellt werden, dass jede Schule dauerhaft über eine eigene School Nurse verfügt“, so Potzmann.
Zur Pressemitteilung: https://oegkv.at/site/assets/files/11631/presseaussendungschoolnurse_final.pdf
Foto: stock.adobe.com - Valerii Honcharuk
-
Als wir nur tüchtige Mädchen waren – Wie wir die Seele der Pflege verstehen
![]()
![]() Christa Olbrich
Christa OlbrichWermeling Verlag, Münster 2025, 213 Seiten, 23,00 €, ISBN 978-3-9821318-7-0
Das Buch mit dem provokanten Titel Als wir nur tüchtige Mädchen waren. Wie wir die Seele der Pflege verstehenbeleuchtet die Sozialisierung und Professionalisierung des Pflegeberufs in Deutschland anhand gesellschaftlicher und (gesundheits)politischer Entwicklungen sowie autobiographischer oftmals auch anekdotischer Bezüge der Autorin.
Prof. em. Dr. phil. Christa Olbrich hat fast das komplette Karriere-Spektrum der Pflege durchlaufen – sie war Krankenhaushelferin, Krankenschwester, Stationsleitung, Pflegepädagogin, hat promoviert und hatte die Professur Pflegedidaktik und Pflegewissenschaft, zeitweise als Dekanin, der Katholischen Hochschule in Mainz inne. Zudem ist sie Autorin verschiedener autobiographischer und fachlicher Bücher, unter anderem auch des Standardwerks Pflegekompetenz. Man kann sie zurecht als eine der Pflegepionierinnen Deutschlands bezeichnen, was auch ihre weiterhin umfangreiche Dozentinnen-/Referentinnentätigkeit zeigt.
Das Werk ist als eine Art Autobiographie im Kontext der Entwicklung des Pflegeberufs anzusehen und zeigt die Möglichkeiten, Ressourcen aber auch Grenzen der zunehmenden Professionalisierung der Pflege in Deutschland auf und endet mit einer Vision, wie sich Pflege weiter entwickeln könnte und sollte.
Anhand der eigenen persönlichen Historie eingebettet in den historischen Wandel der jeweiligen Zeit wird die Professionalisierung und Sozialisierung der Pflege in Deutschland erläutert. Beginnend mit der eigenen Ausbildung als Krankenhaushelferin über die eigene Sozialisierung als Krankenpflegerin mit Leitungsfunktion bis hin zur eigenen Akademisierung mit dem Innehaben einer Professur wird insbesondere auch auf die Rolle und den Blick auf das weibliche Geschlecht mitsamt gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen Bezug genommen und beides miteinander verwoben.
Das Buch bietet einen guten Überblick über die Möglichkeiten der eigenen beruflichen Professionalisierung eingebettet in den jeweiligen Zeitgeist mit Tipps aus persönlichen Anekdoten, manches Mal auch „Grabenkämpfen“ und endet mit einer Vision, wie sich Pflege künftig selbstbewusst, im wahrsten Sinn des Wortes, verorten kann. Somit dient es Pflegenden aller Ebenen, aber auch weiteren Gesundheitsfachberufen (Ärzt:innen hierbei mitgemeint), als Anreiz, die eigene Historie und Karriere sowie berufliche Entwicklungen zu überdenken.
Zwar spannen manche Anekdoten und Bezüge zeitweise den Bogen von der Mikro- hin zur Meso- und Metaebene, allerdings verliert man sich nicht in etwaigen Gedankensprüngen, sondern kann die entsprechenden Erklärungen und gegenseitigen Einflussfaktoren gut nachvollziehen, da sich beides zum Teil gegenseitig bedingt.
Das Ziel des Buchs, die persönliche, berufliche Entwicklung zu reflektieren sowie daraus hervorgehend Chancen und Grenzen auszuloten, wird erreicht, allerdings bleibt die Reflexion des beruflichen Selbstverständnisses oberflächlich, was aber auch durch die generalisierte Unklarheit in selbigem zu erklären ist. Trotz der teils rasanten, nichtsdestotrotz ausländischen Vorbildern um Jahrzehnte hinterherhinkenden, Entwicklung der teils selbsternannten Profession Pflege in Deutschland, bleibt weiterhin unklar, was den Kern pflegerischen Handelns ausmacht. Hierbei wird der Bogen zwischen dem Selbstverständnis als Arzt/Ärzt:inassisstenz bis hin zur selbsterschöpfenden und unerschöpflichen Ganzheitlichkeit gespannt, unklar bleibt allerdings nach wie vor die Frage „Was ist Pflege?“. Die Lösung liegt vermeintlich in der Thematik Vorbehaltsaufgaben bei welcher „die Pflege“ als eine Art Lotsenfunktion fungiert, unscharf bleibt hierbei trotz dessen, welche originären pflegerischen Grundlagenaufgaben dies beinhalten soll. Zwar bietet die Autorin mit dem Thememkomplex „Spiritual Care“ eine Möglichkeit an, allerdings kommt dies der ganzheitlichen Betrachtung und Behandlung des Individuums recht nah.
Das Buch ist aufgrund der Orientierung am historischen Zeitstrahl mitsamt den entsprechenden persönlichen, gesellschaftlichen und (berufs)politischen Entwicklungen übersichtlich gestaltet sowie nachvollziehbar gegliedert und behandelt aufgrund der weiterhin unablässigen Entwicklung im Gesundheitswesen ein äußerst aktuelles Thema. Es lohnt sich nicht nur deshalb, die vergangene vor dem Hintergrund der gegenwärtigen und zukünftigen Entfaltung der Pflege im Rahmen der Lektüre dieses Buchs zu reflektieren. Insgesamt fokussieren die Inhalte vor allem die Krankenpflege und das Krankenhaussetting, die Altenpflegesicht wird teilweise zu wenig adressiert. Auch wenn die Themen Vorbehaltsaufgaben und Verkammerung als mögliche Lösungen benannt werden, muss hierbei festgehalten werden, dass die Pflege in ihrer Gesamtheit wenig Bestrebungen zeigt, sich selbst der sogenannten Disziplinargesellschaft mit einer starken Fokussierung auf Selbstverwirklichung zuzuordnen. Es ist allerdings vor dem Hintergrund der jahrzehntelangen Ressourcenknappheit vollkommen legitim, wenn sich ein Gros des Berufs der passiveren Form der Leistungsgesellschaft zugehörig fühlt, bei der man eher als Empfänger:in von Anweisungen und Entwicklungen reagiert anstatt selbstverwirklichend zu agieren. Somit ist das Buch vor allem auch als Impuls aus Sicht des appellierenden und anpackenden Pioniergeistes anzusehen sowie hieraus hervorgehend, diesen bei der Lektüre (selbst)reflektierend zu nutzen.
Eine Rezension von Marco Sander,
B.A. Pflege und Gesundheitsförderung, M.A. Pflegewissenschaft -
Primary Nursing in der Langzeitpflege
![]()
![]() Tanja Stuhl & Siegfried Bader
Tanja Stuhl & Siegfried BaderSchlütersche Verlagsgesellschaft, Hannover 2025, 268 Seiten, 49,00 €, ISBN 3842609183
Die Langzeitpflege steht vor großen Herausforderungen: Ein wachsender Pflegebedarf, ein steigender Fachkräftemangel und eine oft als unzureichend empfundene Versorgungsqualität setzen Pflegeeinrichtungen zunehmend unter Druck. In diesem Kontext gewinnt das Modell des Primary Nursing zunehmend an Bedeutung. Während es in der Akutpflege bereits etabliert ist, wird es in der Langzeitpflege bislang nur selten systematisch angewendet. Das Buch Primary Nursing in der Langzeitpflege von Tanja Stuhl und Siegfried Bader setzt genau hier an. Es bietet eine umfassende Einführung in das Konzept des Primary Nursing und zeigt auf, wie es erfolgreich in Pflegeeinrichtungen implementiert werden kann. Dabei geht es nicht nur um die theoretischen Grundlagen des Modells, sondern vor allem um konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis.
Tanja Stuhl und Siegfried Bader sind ausgewiesene Expert:innen im Bereich der Pflegeorganisation und -wissenschaft. Beide verfügen über langjährige Erfahrung in der praktischen Pflege sowie in der Entwicklung innovativer Versorgungskonzepte. Stuhl hat sich in ihrer wissenschaftlichen Arbeit intensiv mit Strukturveränderungen in der Pflege beschäftigt und ist als Autorin mehrerer Fachpublikationen bekannt. Bader hingegen bringt seine Expertise als Berater für Pflegeeinrichtungen ein und hat sich auf die Implementierung neuer Organisationsformen spezialisiert.
Die Publikation wurde vor dem Hintergrund der zunehmenden Notwendigkeit entwickelt, neue Versorgungsmodelle in der Langzeitpflege zu etablieren. Während Primary Nursing in Krankenhausstrukturen bereits vielfach erprobt ist, gibt es bisher nur wenige systematische Ansätze zur Umsetzung in Pflegeheimen oder ambulanten Langzeitpflegeeinrichtungen. Das Buch basiert auf aktuellen Forschungsergebnissen, Praxiserfahrungen und Fallstudien aus Einrichtungen, die das Modell bereits implementiert haben. Zudem fließen Erkenntnisse aus interdisziplinären Projekten und Modellversuchen ein, die den Erfolg und die Herausforderungen einer Umstellung auf Primary Nursing in der Langzeitpflege dokumentieren.
Das Buch ist praxisnah und übersichtlich strukturiert. Es beginnt mit einer Einführung in das Konzept des Primary Nursing, seiner historischen Entwicklung und den Grundprinzipien dieses Pflegemodells. Die Autor:innen erläutern, wie Primary Nursing die Beziehung zwischen Pflegekraft und Pflegebedürftigen stärkt, indem eine einzelne Pflegefachperson die umfassende Verantwortung für die Betreuung einer Person übernimmt. Dadurch wird eine kontinuierliche und qualitativ hochwertige Versorgung sichergestellt. Im weiteren Verlauf wird der spezifische Nutzen dieses Modells für die Langzeitpflege herausgearbeitet. Dabei geht es unter anderem um die Frage, warum das herkömmliche Bezugspflegemodell oft nicht ausreicht, um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden. Die Autor:innen beleuchten die strukturellen, organisatorischen und kulturellen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Implementierung und zeigen auf, welche Schritte für eine nachhaltige Veränderung erforderlich sind. Ein besonderer Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung. Es wird detailliert beschrieben, wie Pflegeeinrichtungen den Umstellungsprozess gestalten können, welche Hürden auftreten können und wie mit Widerständen im Team umzugehen ist. Hierbei spielen Schulungskonzepte für Pflegekräfte ebenso eine Rolle wie die Anpassung von Arbeitsprozessen und Dokumentationssystemen. Unterstützt wird die Darstellung durch zahlreiche Abbildungen, Tabellen und Fallbeispiele, die die theoretischen Inhalte anschaulich ergänzen. Das Buch schließt mit einer Reflexion über die Herausforderungen und Chancen von Primary Nursing in der Langzeitpflege. Dabei werden auch mögliche Zukunftsperspektiven für dieses Modell aufgezeigt, insbesondere im Hinblick auf den demografischen Wandel und die Notwendigkeit einer nachhaltigeren Pflegeorganisation.
Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal dieser Publikation ist die systematische Übertragung des Primary Nursing-Konzepts auf die Langzeitpflege. Während es in der Akutversorgung längst erprobt ist, fehlte bisher eine detaillierte Anleitung für die Umsetzung in Pflegeheimen und ambulanten Einrichtungen. Das Buch schließt diese Lücke und liefert erstmals einen strukturierten Implementierungsleitfaden, der auf realen Praxiserfahrungen basiert.
Der Nutzen dieses Buches ist vielfältig. Pflegekräfte profitieren von der Möglichkeit, ihre Arbeit durch mehr Eigenverantwortung und eine intensivere Beziehung zu ihren Patient:innen aufzuwerten. Führungskräfte erhalten einen detaillierten Fahrplan zur Umsetzung des Modells in ihren Einrichtungen und bekommen wertvolle Hinweise zur Organisationsentwicklung. Auch für Pflegeeinrichtungen insgesamt bietet das Buch eine wertvolle Orientierung, um die Versorgungsqualität zu steigern und gleichzeitig die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeitenden zu verbessern.
Die Thematik ist zwar spezifisch auf die Langzeitpflege fokussiert, wird aber in einer Breite und Tiefe behandelt, die weit über eine bloße Einführung hinausgeht. Das Buch bietet nicht nur theoretische Grundlagen, sondern auch einen praxisorientierten Leitfaden, der in allen Schritten der Implementierung unterstützt. Das Ziel der Publikation, eine anwendungsorientierte Einführung in Primary Nursing in der Langzeitpflege zu bieten, wird zweifellos erreicht. Die klare Struktur, die verständliche Sprache und die zahlreichen anschaulichen Beispiele machen es zu einer wertvollen Lektüre sowohl für erfahrene Pflegekräfte als auch für Entscheidungsträger:innen in der Pflegebranche.
Die gestalterische Umsetzung ist gelungen: Die Vielzahl an Abbildungen und Tabellen erleichtert den Zugang zum Inhalt, und die klare Kapitelstruktur ermöglicht eine schnelle Orientierung. Dadurch eignet sich das Buch nicht nur als kontinuierliche Lektüre, sondern auch als Nachschlagewerk für spezifische Fragestellungen in der Praxis. Vergleicht man dieses Buch mit anderen Publikationen zum Thema Primary Nursing, fällt auf, dass die meisten bisherigen Werke sich auf den Krankenhausbereich konzentrieren. Ein Beispiel dafür ist Primary Nursing: Patientenorientierung in der Praxis von Marie Manthey, das sich primär mit der Anwendung in klinischen Settings befasst. Suhl und Bader erweitern den Fokus hingegen auf die Langzeitpflege und schließen damit eine Lücke in der Fachliteratur.
Mit Primary Nursing in der Langzeitpflege legen Tanja Suhl und Siegfried Bader ein fundiertes, praxisnahes und gut strukturiertes Werk vor, das einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung der Pflegeorganisation leistet. Es verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit konkreten Umsetzungshilfen und bietet Pflegeeinrichtungen eine wertvolle Orientierungshilfe für die Einführung dieses Pflegemodells. Besonders für Führungskräfte und Entscheidungsträger:innen in der Pflege ist es eine unverzichtbare Lektüre, die dabei hilft, den Herausforderungen der Langzeitpflege mit innovativen Ansätzen zu begegnen.
Eine Rezension von Denise Vey
-
Projekt EULE: Intelligentes Home-Monitoring zur Unterstützung der häuslichen Pflege
![]() Viele ältere Menschen wünschen sich, möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung zu leben. Doch altersbedingter Muskelabbau, Gangunsicherheiten und eine nachlassende körperliche Leistungsfähigkeit erhöhen das Sturzrisiko und den Pflegebedarf, was die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen kann. Angehörige geraten dadurch oft unter großen Druck, während Pflegedienste aufgrund des Fachkräftemangels an ihre Grenzen stoßen. Moderne Technologien sollen nun dazu beitragen, eine bessere Unterstützung zu ermöglichen.
Viele ältere Menschen wünschen sich, möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung zu leben. Doch altersbedingter Muskelabbau, Gangunsicherheiten und eine nachlassende körperliche Leistungsfähigkeit erhöhen das Sturzrisiko und den Pflegebedarf, was die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen kann. Angehörige geraten dadurch oft unter großen Druck, während Pflegedienste aufgrund des Fachkräftemangels an ihre Grenzen stoßen. Moderne Technologien sollen nun dazu beitragen, eine bessere Unterstützung zu ermöglichen.Das Innovationsprojekt „EULE“ (kurz für „Erkennen und Lernen“) setzt genau hier an. Ziel ist die Entwicklung eines intelligenten Home-Monitoring-Systems, das Pflegekräfte und Angehörige unterstützt und sich nahtlos in den Alltag integriert. Beteiligte Partner sind das Institut für Bewegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation der Deutschen Sporthochschule Köln, die MediTECH Electronic GmbH, die cibX GmbH sowie das Institut für Informatik, Robotik und Kybernetik an der Czech Technical University in Prag. Das internationale Kooperationsprojekt wird mit rund 714.000 Euro aus dem Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz gefördert.
Das System EULE wurde entwickelt, um sowohl Angehörige und Pflegekräfte zu entlasten als auch die Selbstständigkeit älterer Menschen zu fördern. Sensoren erfassen kontinuierlich Bewegungen, Puls, Atmung und weitere Vitalparameter der betreuten Personen und analysieren diese. Bei auffälligen Veränderungen oder akuten Vorfällen – wie etwa einem Sturz – werden sofort individuelle Warnmeldungen ausgelöst. Darüber hinaus wertet das Bewegungsmonitoring EULE alltägliche Bewegungen algorithmisch aus, um ein erhöhtes Sturzrisiko zu erkennen oder Anzeichen für Krankheiten wie Parkinson oder Schlaganfall frühzeitig zu identifizieren. Durch die datenschutzkonforme Integration von Kamera- und Mikrofontechnologien sowie KI-basierter Analyse soll EULE den Pflegebedürftigen ein autonomes Leben im eigenen Zuhause ermöglichen.
Die Abteilung für Bewegungsorientierte Präventions- und Rehabilitationswissenschaften im Institut für Bewegungstherapie und bewegungsorientierte Prävention und Rehabilitation an der Deutschen Sporthochschule Köln wird fortschrittliche Algorithmen entwickeln, die auf Kameradaten basierend Bewegungsparameter, Akutereignisse wie Stürze und pathologische Anomalien in alltäglichen Bewegungen erfassen. Das Monitoring von Gangparametern soll dazu beitragen, Sturzprädiktoren frühzeitig zu identifizieren und Veränderungen sowie pathologische Auffälligkeiten zu detektieren. Auch die Validierung des entwickelten Systems wird von der Deutschen Sporthochschule Köln übernommen. Die MediTECH Electronic GmbH arbeitet an sensorbasierten Messmethoden zur kontaktlosen Erfassung von Vitalparametern wie Puls oder Atmung. Ein von der cibX GmbH entwickelter Voicebot soll die Kommunikation mit den Pflegebedürftigen ermöglichen und durch die Analyse von Stimmparametern Veränderungen in der Sprache der Pflegebedürftigen erkennen. Ergänzend werden Forschende des Tschechischen Instituts für Informatik, Robotik und Kybernetik an der Technischen Universität Prag die Implementierung einer KI zur Analyse und Interpretation der multimodalen Gesundheitsdaten unterstützen.
Die Idee zum Projekt „EULE“ ist im Rahmen des Innovationsnetzwerks AIMECA – Künstliche Intelligenz in der medizinischen Versorgung entstanden, das über das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) gefördert wird. Betreut wird AIMECA von der IWS GmbH, einer Innovationsberatungsagentur, die sich als Bindeglied zwischen Industrie und Spitzenforschung versteht.
Weitere Informationen finden Sie unter www.aimeca.netWissenschaftliche Ansprechpartner:
Prof.‘in Dr. Bettina Wollesen, Projektleitung, Abteilung Bewegungsorientierte Präventions- und Rehabilitationswissenschaften
Tel.: +49 221 4982-4790
E-Mail: b.wollesen@dshs-koeln.de
Carolin Drewes, wissenschaftliche Mitarbeiterin
E-Mail: c.drewes@dshs-koeln.de
Zur Pressemitteilung: https://www.dshs-koeln.de/aktuelles/meldungen-pressemitteilungen/detail/meldung/intelligentes-home-monitoring-zur-unterstuetzung-der-haeuslichen-pflege/
Foto: Projektfoto, Senioren auf dem Sofa mit Home Monitoring System EULE (freepik; KI-generiert)
-
HSBI testet KI-gestützte PainChek® App für verbesserte Schmerzerfassung und Ergebnisse in der Demenzpflege
![]()
Unter der Leitung von Prof. Dr. Rena Amelung vom Fachbereich Gesundheit der Hochschule Bielefeld (HSBI) wird die in Europa zugelassene PainChek®-App zur Schmerzerfassung erstmals in Deutschland getestet. In Zusammenarbeit mit fünf Pflegeheimen untersucht das Forschungsprojekt die Wirksamkeit und Zuverlässigkeit der App bei Patientinnen und Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Demenz, die ihre Schmerzen nicht mehr adäquat verbal äußern können.
Vergleichende Untersuchung zur Schmerzerfassung
Im Rahmen der Studie wird der aktuelle Schmerzzustand der Patientinnen und Patienten parallel mit der deutschsprachigen PainChek®-App sowie der etablierten „Beurteilung von Schmerzen bei Demenz“ (BESD) erfasst. Zudem erfolgt eine Evaluation der Schmerzmedikation gemäß dem WHO-Stufenplan. Ziel ist es, die Einsatzmöglichkeiten der App in der deutschen stationären Langzeitpflege wissenschaftlich zu bewerten.
Hintergrund zur PainChek®-App
PainChek® ist das weltweit erste Medizinprodukt zur Schmerzerfassung mit regulatorischer Zulassung in Australien, Kanada, der Europäischen Union, Neuseeland, Singapur, Malaysia und dem Vereinigten Königreich. Die App analysiert Gesichtsbewegungen sowie weitere Verhaltensindikatoren, um Schmerzen zuverlässig zu erkennen und personalisierte Schmerzprofile zu erstellen.
Die Anwendung basiert auf einem Beobachtungssystem mit 42 Teilbereichen, die Gesicht, Stimme, Bewegung, Verhalten, Aktivität und Körperhaltung erfassen. Die Technologie wurde an der Curtin University in Australien entwickelt und wird dort bereits in rund 45.000 Pflegeeinrichtungen genutzt. Nach einer erfolgreichen Validierungsstudie in Großbritannien 2021 findet die App auch dort Anwendung bei mindestens 15.000 Demenzpatienten und wird vom National Health Service (NHS) erstattet.
Projektorganisation und ethische Prüfung
Die Hochschule Bielefeld übernimmt die Organisation, Datenauswertung und Veröffentlichung der Ergebnisse. Die ethische Freigabe wurde bei der Ethikkommission der Ärztekammer Westfalen-Lippe beantragt.
Das Forschungsprojekt wird von der Firma PainChek finanziert und läuft vom 1. Februar 2025 bis zum 31. Dezember 2025.
Zur Pressemitteilung: https://www.hsbi.de/presse/pressemitteilungen/hsbi-testet-ki-gestuetzte-painchek-c2-ae-app-fuer-verbesserte-schmerzerfassung-und-ergebnisse-in-der-demenzpflege
Foto: Die Teilbereiche in der Domäne "Gesicht" basieren auf dem Kodiersystem für Gesichtsbewegungen. © PainChek
-
WHO: Weltweit mehr Pflegekräfte, aber Verteilung weiterhin ungleich
![]() Laut dem kürzlich veröffentlichten Bericht State of the World’s Nursing 2025, der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem Internationalen Rat der Krankenschwestern (ICN) und Partnern herausgegeben wurde, ist die Zahl der Pflegekräfte weltweit von 27,9 Millionen im Jahr 2018 auf 29,8 Millionen im Jahr 2023 gestiegen. Trotz dieses Wachstums bestehen jedoch nach wie vor erhebliche regionale Unterschiede in der Verfügbarkeit von Pflegekräften.
Laut dem kürzlich veröffentlichten Bericht State of the World’s Nursing 2025, der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem Internationalen Rat der Krankenschwestern (ICN) und Partnern herausgegeben wurde, ist die Zahl der Pflegekräfte weltweit von 27,9 Millionen im Jahr 2018 auf 29,8 Millionen im Jahr 2023 gestiegen. Trotz dieses Wachstums bestehen jedoch nach wie vor erhebliche regionale Unterschiede in der Verfügbarkeit von Pflegekräften.Die ungleichen Verteilungen der Pflegekräfte weltweit hindern viele Menschen daran, grundlegende Gesundheitsdienste zu erhalten. Dies könnte die Fortschritte in Richtung einer universellen Gesundheitsversorgung (UHC), der globalen Gesundheitssicherheit und der gesundheitsbezogenen Entwicklungsziele gefährden. Der Bericht wurde zum Internationalen Tag der Krankenschwestern veröffentlicht und bietet eine umfassende Analyse der Pflegekräfteversorgung auf globaler, regionaler und nationaler Ebene.
Trotz globaler Fortschritte bei der Reduzierung des Mangels an Pflegekräften – von 6,2 Millionen im Jahr 2020 auf 5,8 Millionen im Jahr 2023 – zeigen die Daten, dass etwa 78 % der weltweiten Pflegekräfte in Ländern arbeiten, die nur 49 % der globalen Bevölkerung repräsentieren. Besonders Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen haben Schwierigkeiten, genügend Pflegekräfte auszubilden, zu beschäftigen und im System zu halten. Um diesem Mangel entgegenzuwirken, müssen diese Länder verstärkt in den Aufbau und die Sicherung von Arbeitsplätzen investieren.
Der WHO-Generaldirektor, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, erklärte: „Dieser Bericht enthält ermutigende Nachrichten, und wir gratulieren den Ländern, die Fortschritte machen. Doch wir dürfen die bestehenden Ungleichheiten im globalen Pflegeumfeld nicht ignorieren. Ich fordere die Länder und Partner auf, diesen Bericht als Orientierung zu nutzen, um zu erkennen, wo wir stehen und was noch zu tun ist.“
Ein weiteres zentrales Thema im Bericht sind die sozialen und geschlechtsspezifischen Ungleichheiten. Frauen stellen weiterhin 85 % der globalen Pflegekräfte. Der Bericht hebt auch die bedeutende Rolle von ausländischen Pflegekräften hervor: 1 von 7 Pflegekräften weltweit – und 23 % in Ländern mit hohem Einkommen – stammen aus dem Ausland.
Für die Jahre 2026–2030 fordert der Bericht mehrere politische Prioritäten, darunter die Schaffung und gerechte Verteilung von Pflegearbeitsplätzen, die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, die Förderung von Gleichstellung und der Schutz von Pflegekräften in fragilen und konfliktbeladenen Regionen. Ebenso sollen digitale Technologien genutzt und Pflegekräfte auf eine klimafreundliche Gesundheitsversorgung vorbereitet werden.
Zur Pressemitteilung: https://www.who.int/news/item/12-05-2025-nursing-workforce-grows--but-inequities-threaten-global-health-goals
Foto: stock.adobe.com - Yaw Niel
-
Austausch zwischen Pflegeforschung und -praxis verbessert die Versorgung von Menschen in der Langzeitpflege
![]() Die Städtischen Seniorenheime Krefeld und das Institut für Pflegewissenschaft der Universität zu Köln haben eine langfristige Kooperation vereinbart: Der bis Mai 2030 laufende Vertrag schafft die Grundlage für eine enge Zusammenarbeit im Rahmen eines „Living Lab“ – eines Reallabors zur praxisnahen Pflegeforschung. Ziel des gemeinsamen Projekts „PraWiLab – Vernetzung von Pflegepraxis und Wissenschaft in der Langzeitpflege durch den Living Lab Ansatz“ ist es, den Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis systematisch zu stärken. Pflegewissenschaftliche Erkenntnisse sollen schneller in die praktische Arbeit einfließen, während gleichzeitig Impulse aus dem Pflegealltag neue Forschungsfragen anstoßen.
Die Städtischen Seniorenheime Krefeld und das Institut für Pflegewissenschaft der Universität zu Köln haben eine langfristige Kooperation vereinbart: Der bis Mai 2030 laufende Vertrag schafft die Grundlage für eine enge Zusammenarbeit im Rahmen eines „Living Lab“ – eines Reallabors zur praxisnahen Pflegeforschung. Ziel des gemeinsamen Projekts „PraWiLab – Vernetzung von Pflegepraxis und Wissenschaft in der Langzeitpflege durch den Living Lab Ansatz“ ist es, den Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis systematisch zu stärken. Pflegewissenschaftliche Erkenntnisse sollen schneller in die praktische Arbeit einfließen, während gleichzeitig Impulse aus dem Pflegealltag neue Forschungsfragen anstoßen.Der demografische Wandel, strukturelle Veränderungen im Gesundheits- und Pflegesystem sowie der Rückgang informeller Pflegekapazitäten stellen Einrichtungen der Langzeitpflege vor wachsende Herausforderungen. Wissenschaftliche Erkenntnisse, die sich an den Bedürfnissen pflegebedürftiger Menschen orientieren, können einen wichtigen Beitrag leisten, um diesen Entwicklungen adäquat zu begegnen. In der Praxis kommen solche Erkenntnisse jedoch häufig erst mit erheblicher Verzögerung an: Studien zufolge vergehen im Durchschnitt mehr als zehn Jahre, bis neue pflegewissenschaftliche Ergebnisse in der täglichen Versorgung tatsächlich umgesetzt werden.
Das Institut für Pflegewissenschaft der Universität zu Köln und die Städtischen Seniorenheime Krefeld haben den in den Niederlanden bewährten „Living Lab“-Ansatz bereits in der Projektphase von 2021 bis 2024 erfolgreich im Kontext der Versorgung von Menschen mit Demenz in der Langzeitpflege umgesetzt und wissenschaftlich begleitet. Dieses Forschungsformat nimmt reale Versorgungsherausforderungen als Ausgangspunkt und fasst sie inhaltlich und räumlich klar ab – mit dem Ziel, einen kontinuierlichen Wissensaustausch zwischen Wissenschaft und Praxis zu ermöglichen. Dabei fließen aktuelle, evidenzbasierte Erkenntnisse gezielt in die pflegerische Praxis ein, während gleichzeitig Erfahrungen, Fragestellungen und Herausforderungen aus dem Arbeitsalltag der Pflegenden in die Forschung zurückgespiegelt werden. Das Living Lab schafft so eine strukturierte Plattform für die gemeinsame Bearbeitung aktueller Themen. Pflegekräfte in den Einrichtungen profitieren von neuem wissenschaftlichen Input und einer reflektierten Auseinandersetzung mit ihrer beruflichen Praxis. Für die Wissenschaft eröffnet sich ein regelmäßiger Zugang zum Praxisfeld sowie die Möglichkeit, praxisnahe Forschungsfragen zu entwickeln. Im Zentrum stehen dabei stets die konkreten Bedürfnisse der pflegebedürftigen Menschen und die Weiterentwicklung ihrer Versorgung.
Im aktuellen Projekt übernehmen ausgewählte Wissenschaftlerinnen und Praxisvertreterinnen die Rolle sogenannter „Linking Pins“ – verbindender Personen zwischen Forschung und Pflegepraxis. Ergänzend dazu werden in jedem Quartier der Städtischen Seniorenheime Krefeld lokale Arbeitsgruppen eingerichtet. Diese Gruppen identifizieren gemeinsam mit den Linking Pins relevante Themen aus dem Pflegealltag und bearbeiten sie mithilfe wissenschaftlicher Methoden.
Die thematische Arbeit erfolgt im Rahmen eines Quartierskonzepts. Dieses sieht vor, dass die stationäre Pflegeeinrichtung nicht nur innerhalb ihrer Mauern, sondern auch im direkten Wohnumfeld pflegerische Leistungen erbringt – und das, ohne einen eigenen ambulanten Dienst zu betreiben. Auf diese Weise wird die Einrichtung zu einem aktiven Bestandteil des Quartiers und zu einem festen Anker im sozialen Nahraum. Das ermöglicht älteren Menschen individuelle, flexible und alltagsnahe Unterstützungsangebote, die sich an ihren Lebensumständen orientieren. Ziel ist es, pflegebedürftigen Menschen ein dauerhaftes Leben in ihrer vertrauten Wohnumgebung zu ermöglichen.
Im Verlauf des Projekts entwickeln die Teams aus Wissenschaft und Praxis für die konkreten Themen Lösungsansätze und erproben sie in der Praxis. Dr. Martin Dichter, stellvertretender Leiter des Instituts für Pflegewissenschaft und wissenschaftlicher Leiter des Projekts, sagt: „Im Rahmen des Living Labs können wir kontinuierlich Perspektiven und Wissen zwischen Praxis sowie Wissenschaft teilen. Gemeinsam fördern wir so eine evidenzbasierte Pflege und etablieren für unsere pflegewissenschaftlichen Projekte einen Feldzugang in die ambulante und stationäre Langzeitpflege.“ Jörg Schmidt, Geschäftsführer der Städtischen Seniorenheime Krefeld, ergänzt: „Durch den kontinuierlichen Austausch mit der Wissenschaft steigern wir einerseits unsere Innovationsfähigkeit als Unternehmen. Andererseits schaffen wir durch den Wissenszuwachs der Mitarbeitenden einen qualitativen Gewinn für unsere Menschen mit Pflegebedarf. Damit sind wir sowohl für wissenschafts- als auch für praxisinteressierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein attraktiver Arbeitgeber.“
Das Living Lab Köln-Krefeld ist eng mit dem Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg verbunden, wo ebenfalls ein Living Lab im Bereich der Altenpflege eingerichtet wurde. Darüber hinaus bestehen internationale Kooperationen mit Wissenschaftler*innen der Universitäten Maastricht (Niederlande), Leeds (Vereinigtes Königreich) und Graz (Österreich). An allen drei Hochschulen sind Living Labs in der stationären Langzeitpflege entweder seit vielen Jahren erfolgreich etabliert oder befinden sich derzeit im Aufbau. Diese internationale Vernetzung fördert den fachlichen Austausch und ermöglicht eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Ansatzes.
Wissenschaftliche Ansprechpartner:
Dr. Martin Dichter
Institut für Pflegewissenschaft der Universität zu Köln
+49 221 478 34640
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Zur Pressemitteilung: https://www.uni-koeln.de/universitaet/aktuell/meldungen/meldungen-detail/austausch-zwischen-pflegeforschung-und-praxis-verbessert-die-versorgung-von-menschen-in-der-langzeitpflege
Foto: stock.adobe.com - visoot
-
Demenz hat ein Geschlecht: Neues Forschungsprojekt beleuchtet Unterschiede in der Pflege bei Frauen und Männern
![]() Frauen sind nicht nur häufiger von Demenz betroffen als Männer, sondern erleben auch andere Krankheitsverläufe und gehen anders mit der Diagnose um. Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede wirken sich direkt auf den Alltag und die Pflege aus. Hier setzt das Forschungsprojekt „ParGenDA“ an, das von der Universität Witten/Herdecke (UW/H) gemeinsam mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e. V. Selbsthilfe Demenz (DAlzG) durchgeführt wird. Ziel ist es, den tatsächlichen Unterstützungsbedarf von Betroffenen und Pflegenden zu ermitteln. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.
Frauen sind nicht nur häufiger von Demenz betroffen als Männer, sondern erleben auch andere Krankheitsverläufe und gehen anders mit der Diagnose um. Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede wirken sich direkt auf den Alltag und die Pflege aus. Hier setzt das Forschungsprojekt „ParGenDA“ an, das von der Universität Witten/Herdecke (UW/H) gemeinsam mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e. V. Selbsthilfe Demenz (DAlzG) durchgeführt wird. Ziel ist es, den tatsächlichen Unterstützungsbedarf von Betroffenen und Pflegenden zu ermitteln. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.Forschung, die bei den Menschen ansetzt
Über einen Zeitraum von 18 Monaten erarbeiten Pflegewissenschaftler:innen der Universität Witten gemeinsam mit Menschen mit Demenz, pflegenden Angehörigen, deren Interessenvertretungen und Fachleuten zentrale Fragestellungen zu geschlechtsspezifischen Unterschieden, die bislang in Forschung und Versorgung wenig Beachtung fanden. Im Projektverlauf beantworten die Teilnehmenden einen Fragebogen, der Themen wie alltägliche Belastungen sowie emotionale und soziale Auswirkungen von Demenz abdeckt. Die Antworten werden mit bestehenden wissenschaftlichen Erkenntnissen verglichen. In einem abschließenden Workshop erstellen die Beteiligten eine Liste der zehn wichtigsten offenen Fragen zur gendersensiblen psychosozialen Unterstützung.
„Gendersensible Medizin als Stichwort und die Frage nach genderspezifischen Therapien sind inzwischen im Bewusstsein von Gesellschaft und Wissenschaft angekommen“, erklärt Prof. Dr. Margareta Halek von der UW/H. „Weniger klar ist der Bezug zur Pflege von Menschen mit Demenz: Es gibt Hinweise, dass Frauen häufiger depressive oder wahrnehmungsverändernde Symptome zeigen, Männer dagegen eher starke Unruhe.“
Auch die Pflege selbst stelle je nach Geschlecht unterschiedliche Anforderungen, so Halek weiter: „Meist übernehmen Frauen die Pflege von Menschen mit Demenz – als Ehefrauen, Töchter oder Schwiegertöchter. Psychosoziale Angebote sind entsprechend stärker auf Frauen ausgerichtet, während Männer als pflegende Angehörige wenig sichtbar sind. In der Pflegeforschung werden all diese Geschlechterdifferenzen bislang nicht hinreichend untersucht oder in Neuentwicklungen einbezogen. Entsprechend fehlen gendersensible Vorschläge für die Pflegepraxis.“
Agenda für Forschung und eine zielgenaue Gesundheitspolitik
Die im Projekt „ParGenDA“ erarbeiteten Forschungsfragen sollen gezielt in zukünftige Studien, Fördermaßnahmen und gesundheitspolitische Konzepte einfließen, um bestehende Versorgungslücken zu schließen. Langfristig trägt das Projekt dazu bei, geschlechtersensible Perspektiven in der Versorgung von Menschen mit Demenz stärker zu berücksichtigen – etwa durch Anpassungen in der Aus- und Weiterbildung von Gesundheitsfachkräften oder durch die Entwicklung neuer psychosozialer Unterstützungsangebote.
„Wir brauchen eine Forschung, die nah an der Lebensrealität von Betroffenen ist“, sagt Saskia Weiß, Geschäftsführerin der DAlzG. „Nur wer die richtigen Fragen stellt, kann auch die richtigen Antworten finden – und die Versorgung so optimieren, dass sie den Menschen wirklich hilft.“
Weitere Informationen: ParGenDA ist die Abkürzung für „Partnership zu geschlechtersensiblen psychosozialen Interventionen für Menschen mit Demenz und ihre pflegenden Angehörigen“. Das auf 18 Monate angelegte Forschungsprojekt wird vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt gefördert und von der Universität Witten/Herdecke koordiniert. Projektpartner ist die Deutsche Alzheimer Gesellschaft e. V. Selbsthilfe Demenz. Eine Steuerungsgruppe aus Menschen mit Demenz, pflegenden Angehörigen, Fachkräften aus Pflege und Medizin sowie deren Interessenvertretungen begleitet den gesamten Prozess – von der Frageentwicklung bis zur Priorisierung.
Zur Pressemitteilung: https://www.uni-wh.de/demenz-hat-ein-geschlecht-neues-forschungsprojekt-beleuchtet-unterschiede-in-der-pflege-bei-frauen-und-maennern
Foto: stock.adobe.com - fidaolga
-
Hochschule Osnabrück stärkt onkologische Pflegeforschung
![]() In Deutschland erhalten jährlich rund 500.000 Menschen eine Krebsdiagnose, insgesamt leben etwa 4,5 Millionen mit der Erkrankung. Die teils hochkomplexen Krankheitsverläufe und ihre Wechselwirkungen mit anderen chronischen Erkrankungen wurden bislang jedoch kaum systematisch aus pflegewissenschaftlicher Sicht empirisch erforscht.
In Deutschland erhalten jährlich rund 500.000 Menschen eine Krebsdiagnose, insgesamt leben etwa 4,5 Millionen mit der Erkrankung. Die teils hochkomplexen Krankheitsverläufe und ihre Wechselwirkungen mit anderen chronischen Erkrankungen wurden bislang jedoch kaum systematisch aus pflegewissenschaftlicher Sicht empirisch erforscht.Das neue Forschungsprojekt „Pflegebedürftigkeit und onkologische Erkrankungen: Theoretische und methodische Weiterentwicklung zur Etablierung der Pflegeforschung in Deutschland“ (PoWEr) widmet sich genau diesem Themenbereich. Die Pflegewissenschaftlerin Prof. Dr. Sara Marquard von der Hochschule Osnabrück leitet das Projekt, das vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) im Rahmen der BMBF-Förderlinie zur Stärkung der Pflegeforschung mit rund einer Million Euro für zunächst drei Jahre unterstützt wird.
Entwicklung und Etablierung der Onkologiepflege
„Wir verfolgen mit dem Projekt ein übergeordnetes Ziel, nämlich den Aufbau einer pflegewissenschaftlichen Infrastruktur, damit die systematische Bearbeitung wichtiger onkologischer Forschungsfragen überhaupt möglich wird und sich die Onkologiepflege in Deutschland weiterentwickelt. Hier gibt es noch viel zu tun, wir leisten mit unserem Forschungsvorhaben Pionierarbeit, indem wir beispielsweise untersuchen, wie Sekundärdaten unter pflegewissenschaftlichen Gesichtspunkten analysiert werden können und welche ergänzenden Datensätze erforderlich sind, um das Forschungsfeld umfassend zu erschließen“, ordnet Projektleiterin Marquard das Vorhaben in einen größeren Kontext ein.
Um dieses Ziel zu erreichen, sammelt und analysiert das Forschungsteam zunächst verlässliche Daten und verknüpft diese miteinander. Zudem werden bestehende theoretische Konzepte und methodische Ansätze geprüft, diskutiert und bei Bedarf weiterentwickelt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt darauf, die relevanten Akteure zu vernetzen und eine Gemeinschaft für onkologische Pflegeforschung aufzubauen.
Drei Ziele: Versorgungsqualität messbar machen, Guidebook für Pflegeforschung entwickeln, Pflegenetzwerk Onkologie aufbauen
Somit verfolgt Marquard neben dem übergeordneten Ziel, die Onkologiepflege in Deutschland zu stärken und weiterzuentwickeln, drei wissenschaftliche Teilziele: „Erstens möchten wir eine Teiltheorie „Pflegebedürftigkeit und Krebserkrankungen“ entwickeln, die sich mit den Besonderheiten und Herausforderungen in der Pflege von Krebskranken und typischen Verläufen in der Langzeitpflege befasst. Zweitens werden wir ein Guidebook zur Nutzung von Sekundärdaten in der Pflegeforschung“ erstellen, um die Planung und Durchführung von Studien zu erleichtern. Und drittens verfolgen wir den Aufbau eines „Pflegeforschungsnetzwerks Onkologie,“ das verstreute Expertise zusammenführt, international aufgestellt ist und in der Forschung mitdiskutiert.“
Wissenschaftliche Ansprechpartnerin:
Sara Marquard
Professorin für Pflegewissenschaft
E-Mail:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Zur Pressemitteilung: https://www.hs-osnabrueck.de/nachrichten/2025/06/staerkung-der-onkologischen-pflegeforschung/
Foto: stock.adobe.com - Art_Photo



 Pflegende Angehörige leisten im Verborgenen Großes: Etwa eine Million Menschen in Österreich versorgen ihre Angehörigen zu Hause. Die FH Kärnten und das Rote Kreuz Kärnten unterstützen sie mit praxisnahen Workshops und digitalen Lernangeboten. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben das Rote Kreuz Kärnten und die FH Kärnten eine praxisorientierte Workshopreihe ins Leben gerufen. Durch gezielte Schulungen sollen sie mehr Zeit und Lebensqualität gewinnen und ihre Aufgaben leichter bewältigen können.
Pflegende Angehörige leisten im Verborgenen Großes: Etwa eine Million Menschen in Österreich versorgen ihre Angehörigen zu Hause. Die FH Kärnten und das Rote Kreuz Kärnten unterstützen sie mit praxisnahen Workshops und digitalen Lernangeboten. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben das Rote Kreuz Kärnten und die FH Kärnten eine praxisorientierte Workshopreihe ins Leben gerufen. Durch gezielte Schulungen sollen sie mehr Zeit und Lebensqualität gewinnen und ihre Aufgaben leichter bewältigen können. Der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) begrüßt die Ausweitung der School Nurses in Wien und fordert eine nachhaltige Implementierung dieser wichtigen Unterstützung im Schulalltag. Der ÖGKV hat sich lange für diese Maßnahme eingesetzt und sieht die aktuelle Entwicklung als wichtigen Erfolg für die Gesundheitsversorgung in Schulen
Der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) begrüßt die Ausweitung der School Nurses in Wien und fordert eine nachhaltige Implementierung dieser wichtigen Unterstützung im Schulalltag. Der ÖGKV hat sich lange für diese Maßnahme eingesetzt und sieht die aktuelle Entwicklung als wichtigen Erfolg für die Gesundheitsversorgung in Schulen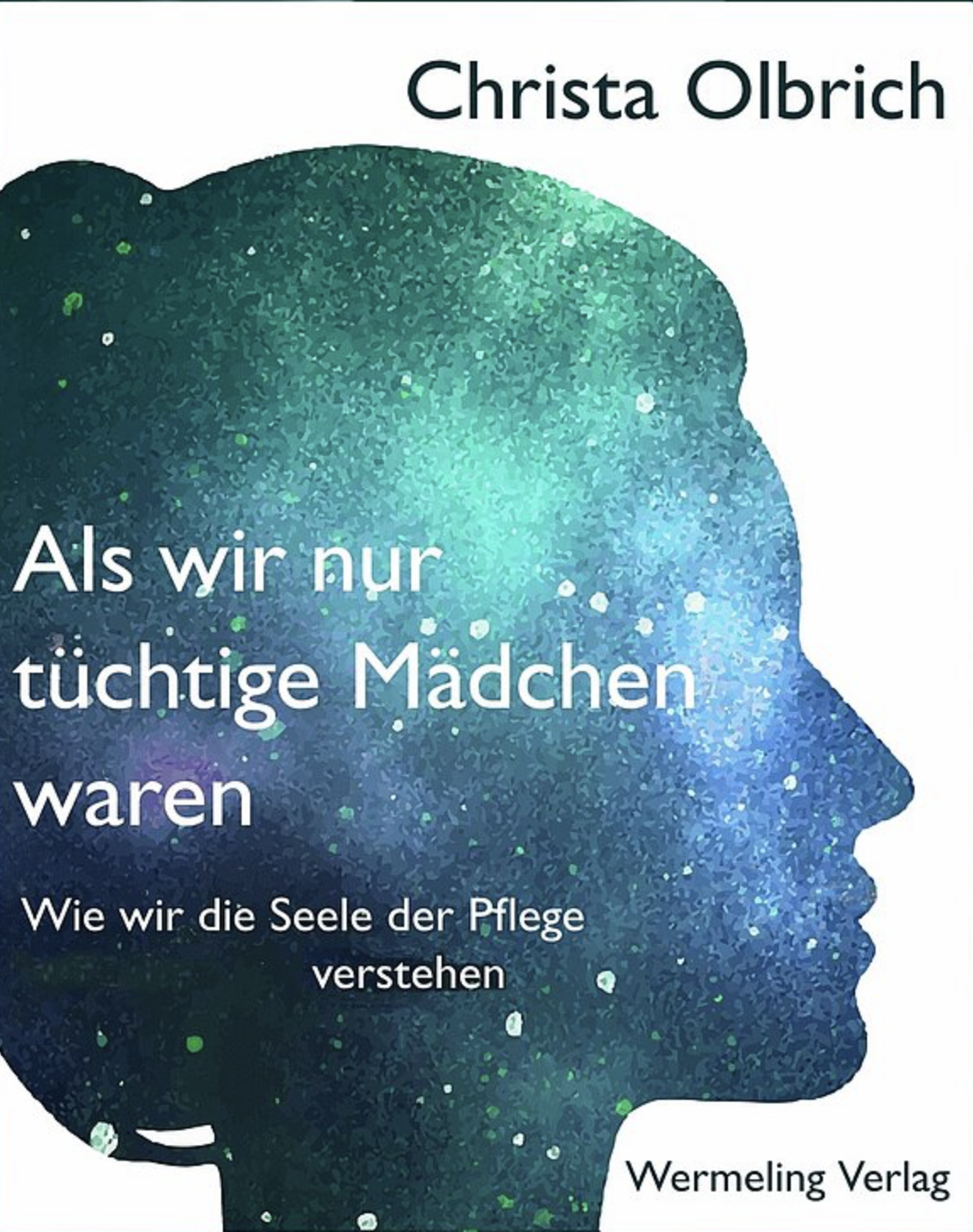
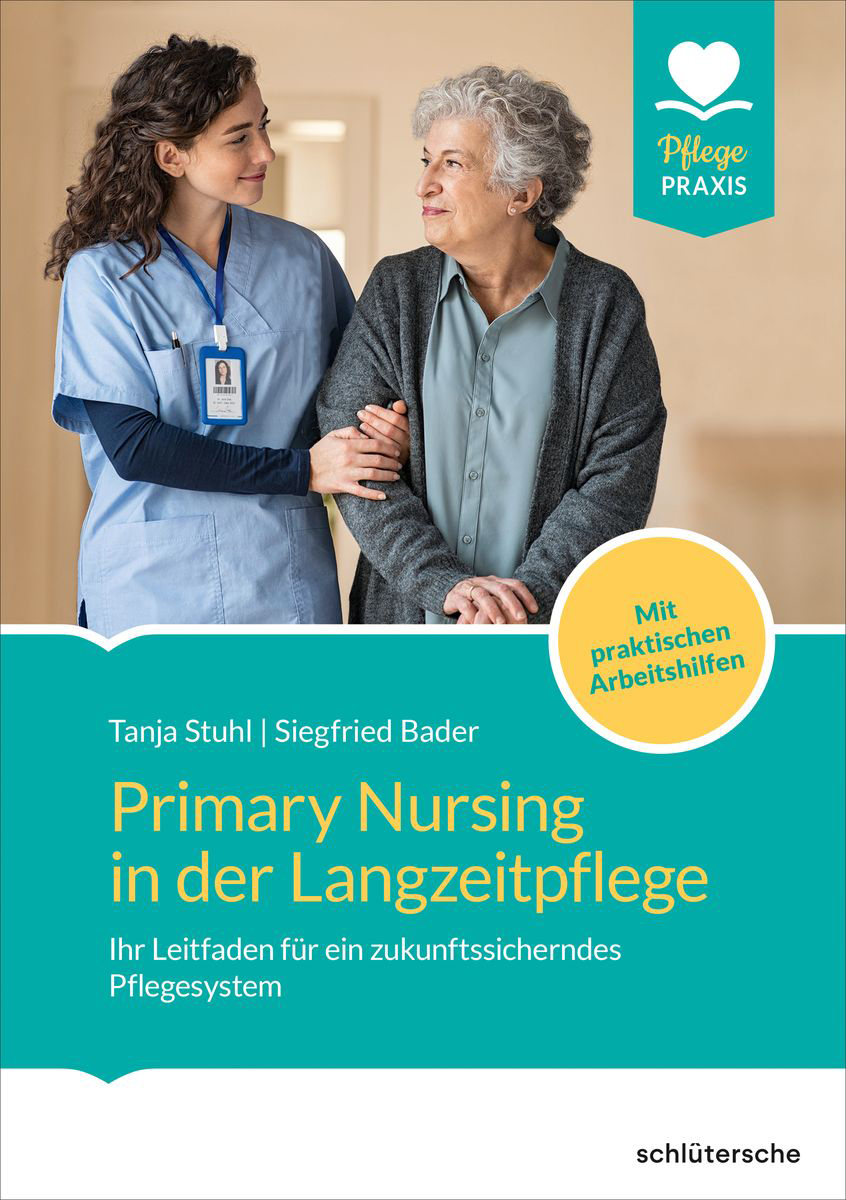
 Viele ältere Menschen wünschen sich, möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung zu leben. Doch altersbedingter Muskelabbau, Gangunsicherheiten und eine nachlassende körperliche Leistungsfähigkeit erhöhen das Sturzrisiko und den Pflegebedarf, was die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen kann. Angehörige geraten dadurch oft unter großen Druck, während Pflegedienste aufgrund des Fachkräftemangels an ihre Grenzen stoßen. Moderne Technologien sollen nun dazu beitragen, eine bessere Unterstützung zu ermöglichen.
Viele ältere Menschen wünschen sich, möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung zu leben. Doch altersbedingter Muskelabbau, Gangunsicherheiten und eine nachlassende körperliche Leistungsfähigkeit erhöhen das Sturzrisiko und den Pflegebedarf, was die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen kann. Angehörige geraten dadurch oft unter großen Druck, während Pflegedienste aufgrund des Fachkräftemangels an ihre Grenzen stoßen. Moderne Technologien sollen nun dazu beitragen, eine bessere Unterstützung zu ermöglichen.
 Laut dem kürzlich veröffentlichten Bericht State of the World’s Nursing 2025, der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem Internationalen Rat der Krankenschwestern (ICN) und Partnern herausgegeben wurde, ist die Zahl der Pflegekräfte weltweit von 27,9 Millionen im Jahr 2018 auf 29,8 Millionen im Jahr 2023 gestiegen. Trotz dieses Wachstums bestehen jedoch nach wie vor erhebliche regionale Unterschiede in der Verfügbarkeit von Pflegekräften.
Laut dem kürzlich veröffentlichten Bericht State of the World’s Nursing 2025, der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO), dem Internationalen Rat der Krankenschwestern (ICN) und Partnern herausgegeben wurde, ist die Zahl der Pflegekräfte weltweit von 27,9 Millionen im Jahr 2018 auf 29,8 Millionen im Jahr 2023 gestiegen. Trotz dieses Wachstums bestehen jedoch nach wie vor erhebliche regionale Unterschiede in der Verfügbarkeit von Pflegekräften. Die Städtischen Seniorenheime Krefeld und das Institut für Pflegewissenschaft der Universität zu Köln haben eine langfristige Kooperation vereinbart: Der bis Mai 2030 laufende Vertrag schafft die Grundlage für eine enge Zusammenarbeit im Rahmen eines „Living Lab“ – eines Reallabors zur praxisnahen Pflegeforschung. Ziel des gemeinsamen Projekts „PraWiLab – Vernetzung von Pflegepraxis und Wissenschaft in der Langzeitpflege durch den Living Lab Ansatz“ ist es, den Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis systematisch zu stärken. Pflegewissenschaftliche Erkenntnisse sollen schneller in die praktische Arbeit einfließen, während gleichzeitig Impulse aus dem Pflegealltag neue Forschungsfragen anstoßen.
Die Städtischen Seniorenheime Krefeld und das Institut für Pflegewissenschaft der Universität zu Köln haben eine langfristige Kooperation vereinbart: Der bis Mai 2030 laufende Vertrag schafft die Grundlage für eine enge Zusammenarbeit im Rahmen eines „Living Lab“ – eines Reallabors zur praxisnahen Pflegeforschung. Ziel des gemeinsamen Projekts „PraWiLab – Vernetzung von Pflegepraxis und Wissenschaft in der Langzeitpflege durch den Living Lab Ansatz“ ist es, den Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis systematisch zu stärken. Pflegewissenschaftliche Erkenntnisse sollen schneller in die praktische Arbeit einfließen, während gleichzeitig Impulse aus dem Pflegealltag neue Forschungsfragen anstoßen. Frauen sind nicht nur häufiger von Demenz betroffen als Männer, sondern erleben auch andere Krankheitsverläufe und gehen anders mit der Diagnose um. Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede wirken sich direkt auf den Alltag und die Pflege aus. Hier setzt das Forschungsprojekt „ParGenDA“ an, das von der Universität Witten/Herdecke (UW/H) gemeinsam mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e. V. Selbsthilfe Demenz (DAlzG) durchgeführt wird. Ziel ist es, den tatsächlichen Unterstützungsbedarf von Betroffenen und Pflegenden zu ermitteln. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt.
Frauen sind nicht nur häufiger von Demenz betroffen als Männer, sondern erleben auch andere Krankheitsverläufe und gehen anders mit der Diagnose um. Diese geschlechtsspezifischen Unterschiede wirken sich direkt auf den Alltag und die Pflege aus. Hier setzt das Forschungsprojekt „ParGenDA“ an, das von der Universität Witten/Herdecke (UW/H) gemeinsam mit der Deutschen Alzheimer Gesellschaft e. V. Selbsthilfe Demenz (DAlzG) durchgeführt wird. Ziel ist es, den tatsächlichen Unterstützungsbedarf von Betroffenen und Pflegenden zu ermitteln. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt. In Deutschland erhalten jährlich rund 500.000 Menschen eine Krebsdiagnose, insgesamt leben etwa 4,5 Millionen mit der Erkrankung. Die teils hochkomplexen Krankheitsverläufe und ihre Wechselwirkungen mit anderen chronischen Erkrankungen wurden bislang jedoch kaum systematisch aus pflegewissenschaftlicher Sicht empirisch erforscht.
In Deutschland erhalten jährlich rund 500.000 Menschen eine Krebsdiagnose, insgesamt leben etwa 4,5 Millionen mit der Erkrankung. Die teils hochkomplexen Krankheitsverläufe und ihre Wechselwirkungen mit anderen chronischen Erkrankungen wurden bislang jedoch kaum systematisch aus pflegewissenschaftlicher Sicht empirisch erforscht.