-
DNQP: Aufruf zur Bewerbung als wissenschaftliche Leitung der Expert*innenarbeitsgruppe zum Thema "Delir"
![]()
Die wissenschaftliche Leitung der Expert*innenarbeitsgruppe zeichnet verantwortlich für die Erstellung einer evidenzbasierten Literaturstudie und das wissenschaftliche Niveau von Expertenstandard und Kommentierungen unter Berücksichtigung von Praxisbedingungen. Wünschenswert ist die Zusicherung der Verfügbarkeit von zwei wissenschaftlichen Mitarbeitern bzw. Mitarbeiterinnen mit entsprechender Qualifikation für die Recherche und Bewertung der Literatur und Erstellung einer Literaturstudie nach anerkannten Verfahren. Entsprechende finanzielle Mittel hierfür werden durch das DNQP bereitgestellt. Die Position der wissenschaftlichen Leitung ist ehrenamtlich, anfallende Reise- und Übernachtungskosten werden erstattet.
In enger Zusammenarbeit mit dem wissenschaftlichen Team des DNQP entwickeln die wissenschaftliche Leitung und die Expert*innenarbeitsgruppe auf Basis einer Literaturstudie einen Entwurf des Expertenstandards, der auf einer Konsensus-Konferenz 2027 der Fachöffentlichkeit vorgestellt wird. Der Start der Entwicklung ist für den Sommer 2025 geplant. Detaillierte Hinweise zur Vorgehensweise finden sich im Papier zum methodischen Vorgehen zur Entwicklung, Einführung und Aktualisierung von Expertenstandards des DNQP (www.dnqp.de/methodisches-vorgehen).
Neben einer Darlegung der fachlichen Expertise werden die Bewerber*innen gebeten, eigene Interessen, Verbindungen zur Industrie oder Interessensverbänden offen zu legen, um die wissenschaftliche Unabhängigkeit des Expertenstandards garantieren zu können. Die Mitglieder einer neuen Expert*innenarbeitsgruppe werden in einem weiteren Bewerbungsverfahren gemeinsam mit der wissenschaftlichen Leitung ausgewählt. Hierzu erfolgt ein gesonderter Aufruf zur Bewerbung im März 2025.
Bewerbungen (gerne auch per E-Mail) werden bis zum 15. März 2025 an folgende Anschrift erbeten:
Deutsches Netzwerk für Qualitätsentwicklung in der Pflege (DNQP)
an der Hochschule OsnabrückWissenschaftliche Leitung: Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Büscher
Postfach 19 40, 49009 Osnabrück
E-Mail:Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Internet: www.dnqp.de -
FH Kärnten unterstützt pflegende Angehörige durch innovative Workshopreihe
![]() Pflegende Angehörige leisten im Verborgenen Großes: Etwa eine Million Menschen in Österreich versorgen ihre Angehörigen zu Hause. Die FH Kärnten und das Rote Kreuz Kärnten unterstützen sie mit praxisnahen Workshops und digitalen Lernangeboten. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben das Rote Kreuz Kärnten und die FH Kärnten eine praxisorientierte Workshopreihe ins Leben gerufen. Durch gezielte Schulungen sollen sie mehr Zeit und Lebensqualität gewinnen und ihre Aufgaben leichter bewältigen können.
Pflegende Angehörige leisten im Verborgenen Großes: Etwa eine Million Menschen in Österreich versorgen ihre Angehörigen zu Hause. Die FH Kärnten und das Rote Kreuz Kärnten unterstützen sie mit praxisnahen Workshops und digitalen Lernangeboten. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben das Rote Kreuz Kärnten und die FH Kärnten eine praxisorientierte Workshopreihe ins Leben gerufen. Durch gezielte Schulungen sollen sie mehr Zeit und Lebensqualität gewinnen und ihre Aufgaben leichter bewältigen können.Wissen aus der FH für die Praxis: Workshops für den Pflegealltag
Die FH Kärnten vermittelt in der Workshopreihe wissenschaftlich fundiertes Wissen und nutzt innovative Lehrmethoden. Das VIDSONS-Projekt (Video Lessons) spielt dabei eine zentrale Rolle, indem es den Teilnehmenden eine flexible, multimediale Begleitung über die Präsenzworkshops hinaus bietet.
„Mit der Workshopreihe kann die FH Kärnten Wissen und Ressourcen, welche im Rahmen der Lehr- und Lernförderung an der FH Kärnten geschaffen wurden, auch an diese so wichtige Gruppe der Pflegenden Angehörigen weitergeben und so einen wichtigen Beitrag für die Versorgung von zu Pflegenden leisten“ sagt Martin Schusser, Leiter des Projekts.
Die Workshops decken relevante Themen des Pflegealltags ab, darunter:
- Transfertechniken: Sicheres Heben und Umlagern von Pflegebedürftigen
- Ergonomie: Tipps zur gesunden Körperhaltung für Pflegende
- Sturzprophylaxe: Strategien zur Vermeidung von Stürzen
- Hilfsmittelversorgung: Einsatz praktischer unterstützender Geräte
Die Termine der Workshops sind:
- 18.02.2025, 18:00 Uhr: Rotkreuz-Bezirksstelle Klagenfurt
- 19.02.2025, 18:00 Uhr: Rotkreuz-Bezirksstelle Villach
- 20.02.2025, 18:00 Uhr: Rotkreuz-Bezirksstelle Wolfsberg
Anmeldungen sind online unter https://shorturl.at/AwtAq bis jeweils 20:00 Uhr am Vortag möglich. Die Workshops finden nur bei mindestens 10 Anmeldungen statt.
VIDSONS: Lernen zu Hause - jederzeit und flexibel
Das Besondere an diesem Projekt ist die begleitende Nutzung der im Rahmen des VIDSONS-Projekts erstellten Lernvideos. Diese wurden von der FH Kärnten konzipiert und bieten den Teilnehmer:innen eine flexible Möglichkeit, das Gelernte zu Hause jederzeit zu vertiefen.
Die Videos sind über den offiziellen YouTube-Kanal „VIDSONS - Video Lessons“ abrufbar:
VIDSONS Playlist auf YouTubeUnterstützung, die ankommt
„Pflegende Angehörige sind oft schwer erreichbar, da sie vollständig in ihre Pflegeaufgaben eingebunden sind. Uns ist es daher wichtig, einen besonders niederschwelligen Zugang zu diesen Unterstützungsangeboten zu schaffen,“ betont Brigitte Pekastnig, 3. Rotkreuz-Vizepräsidentin und Referentin für Gesundheits- und Soziale Dienste.
Die Initiative der FH Kärnten und des Roten Kreuzes Kärnten zielt darauf ab, den Alltag pflegender Angehöriger zu erleichtern und auf die oft unsichtbaren Herausforderungen dieser Aufgabe aufmerksam zu machen. Das gemeinsame Ziel ist es, die häusliche Pflege sicherer, gesünder und einfacher zu gestalten.
Zur Pressemitteilung: https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20250205_OTS0079/fh-kaernten-unterstuetzt-pflegende-angehoerige-durch-innovative-workshopreihe-zentrale-rolle-des-vidsons-projekts
Foto: stock.adobe.com - maxbelchenko
-
Pflegekammer NRW bittet um Praxis-Feedback zur Fachweiterbildung Geriatrie und Gerontopsychiatrie
![]() Die Fachweiterbildung „Geriatrie und Gerontopsychiatrie“ erhält eine neue Rahmenvorgabe. Diese legt inhaltliche und qualitative Standards fest, die für die spezialisierte pflegerische Versorgung älterer und psychisch erkrankter Menschen von zentraler Bedeutung sind. Die Vorgabe wurde durch einen Unterausschuss des Bildungsausschusses der Pflegekammer NRW erarbeitet – nun sind Praxisexpertinnen und -experten aufgerufen, sich an der Weiterentwicklung zu beteiligen.
Die Fachweiterbildung „Geriatrie und Gerontopsychiatrie“ erhält eine neue Rahmenvorgabe. Diese legt inhaltliche und qualitative Standards fest, die für die spezialisierte pflegerische Versorgung älterer und psychisch erkrankter Menschen von zentraler Bedeutung sind. Die Vorgabe wurde durch einen Unterausschuss des Bildungsausschusses der Pflegekammer NRW erarbeitet – nun sind Praxisexpertinnen und -experten aufgerufen, sich an der Weiterentwicklung zu beteiligen.Damit die Rahmenvorgabe die Realität in der Pflege bestmöglich widerspiegelt und aktuelle Herausforderungen berücksichtigt, wird um fachliche Einschätzungen und Anregungen aus der Praxis gebeten. Pflegekräfte haben so die Möglichkeit, aktiv an der Zukunft der Fachweiterbildung mitzuwirken.
Warum ist Ihre Beteiligung wichtig?
– Praxisnähe: Ihre Erfahrungen aus dem Berufsalltag helfen dabei, praxisgerechte und umsetzbare Inhalte zu gestalten.
– Qualitätssicherung: Eine fundierte Weiterbildung trägt langfristig zur Qualitätssicherung in der Pflege und zur beruflichen Entwicklung bei.
– Mitbestimmung: Ihre Rückmeldungen stärken die Mitbestimmung und ermöglichen eine direkte Einflussnahme auf die Weiterbildungsgestaltung.Die Rahmenvorgabe ist hier abrufbar: Fachweiterbildung „Geriatrie und Gerontopsychiatrie“
So geben Sie Ihr Feedback ab:
Senden Sie Ihre Rückmeldung bis zum 13. April 2025 an:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. Die Pflegekammer NRW freut sich über wertvolle Beiträge und dankt allen Teilnehmenden für ihr Engagement.
Zur Pressemitteilung: https://www.pflegekammer-nrw.de/geriatrie-und-gerontopsychiatrie/
Foto: stock.adobe.com - Chinnapong
-
AltenpflegePreis 2025 ausgeschrieben
![]() Der AltenpflegePreis 2025 würdigt innovative Konzepte, die eine hohe Pflegequalität auch in Zeiten von Fachkräftemangel und neuen Arbeitsorganisationen sicherstellen. Ziel des Preises ist es, herausragende Ansätze in der Altenpflege auf einer bundesweiten Plattform zu präsentieren und so den Austausch sowie die Weiterentwicklung in der Branche zu fördern. Der renommierte Preis ehrt Konzepte, die das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner konsequent in den Mittelpunkt stellen.
Der AltenpflegePreis 2025 würdigt innovative Konzepte, die eine hohe Pflegequalität auch in Zeiten von Fachkräftemangel und neuen Arbeitsorganisationen sicherstellen. Ziel des Preises ist es, herausragende Ansätze in der Altenpflege auf einer bundesweiten Plattform zu präsentieren und so den Austausch sowie die Weiterentwicklung in der Branche zu fördern. Der renommierte Preis ehrt Konzepte, die das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner konsequent in den Mittelpunkt stellen."Hochwertige Pflege bedeutet, den Menschen in seiner Würde zu achten", betont Miriam von Bardeleben, Chefredakteurin der Fachzeitschrift Altenpflege. Der Preis bietet nicht nur eine feierliche Auszeichnung in der Einrichtung, sondern auch eine bedeutende Mediale Präsenz, die das Engagement und die Innovationen der besten Pflegeeinrichtungen einem breiten Publikum zugänglich macht. Die Gewinner erhalten einen exklusiven Schwerpunktartikel in der Fachzeitschrift Altenpflege sowie die Möglichkeit, ihr Konzept auf dem AltenpflegeKongress 2025/2026 zu präsentieren.
Zusätzlich honoriert der AltenpflegePreis 2025 das Engagement mit einem Preisgeld von 3.000 Euro.
Bewerbungen sind bis zum 6. Juni 2025 möglich. Weitere Informationen und den Bewerbungsleitfaden finden Sie auf der Projektseite: https://www.altenpflege-online.net/altenpflegepreis/
Zur Pressemitteilung: https://www.altenpflege-online.net/altenpflegepreis-2025-jetzt-bewerben-und-gewinnen/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=Head_AltenpflegePreis+2025%3A+Jetzt+bewerben+und+gewinnen&utm_campaign=AP_NL_20250320
Foto: stock.adobe.com - Kzenon
-
Als wir nur tüchtige Mädchen waren – Wie wir die Seele der Pflege verstehen
![]()
![]() Christa Olbrich
Christa OlbrichWermeling Verlag, Münster 2025, 213 Seiten, 23,00 €, ISBN 978-3-9821318-7-0
Das Buch mit dem provokanten Titel Als wir nur tüchtige Mädchen waren. Wie wir die Seele der Pflege verstehenbeleuchtet die Sozialisierung und Professionalisierung des Pflegeberufs in Deutschland anhand gesellschaftlicher und (gesundheits)politischer Entwicklungen sowie autobiographischer oftmals auch anekdotischer Bezüge der Autorin.
Prof. em. Dr. phil. Christa Olbrich hat fast das komplette Karriere-Spektrum der Pflege durchlaufen – sie war Krankenhaushelferin, Krankenschwester, Stationsleitung, Pflegepädagogin, hat promoviert und hatte die Professur Pflegedidaktik und Pflegewissenschaft, zeitweise als Dekanin, der Katholischen Hochschule in Mainz inne. Zudem ist sie Autorin verschiedener autobiographischer und fachlicher Bücher, unter anderem auch des Standardwerks Pflegekompetenz. Man kann sie zurecht als eine der Pflegepionierinnen Deutschlands bezeichnen, was auch ihre weiterhin umfangreiche Dozentinnen-/Referentinnentätigkeit zeigt.
Das Werk ist als eine Art Autobiographie im Kontext der Entwicklung des Pflegeberufs anzusehen und zeigt die Möglichkeiten, Ressourcen aber auch Grenzen der zunehmenden Professionalisierung der Pflege in Deutschland auf und endet mit einer Vision, wie sich Pflege weiter entwickeln könnte und sollte.
Anhand der eigenen persönlichen Historie eingebettet in den historischen Wandel der jeweiligen Zeit wird die Professionalisierung und Sozialisierung der Pflege in Deutschland erläutert. Beginnend mit der eigenen Ausbildung als Krankenhaushelferin über die eigene Sozialisierung als Krankenpflegerin mit Leitungsfunktion bis hin zur eigenen Akademisierung mit dem Innehaben einer Professur wird insbesondere auch auf die Rolle und den Blick auf das weibliche Geschlecht mitsamt gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen Bezug genommen und beides miteinander verwoben.
Das Buch bietet einen guten Überblick über die Möglichkeiten der eigenen beruflichen Professionalisierung eingebettet in den jeweiligen Zeitgeist mit Tipps aus persönlichen Anekdoten, manches Mal auch „Grabenkämpfen“ und endet mit einer Vision, wie sich Pflege künftig selbstbewusst, im wahrsten Sinn des Wortes, verorten kann. Somit dient es Pflegenden aller Ebenen, aber auch weiteren Gesundheitsfachberufen (Ärzt:innen hierbei mitgemeint), als Anreiz, die eigene Historie und Karriere sowie berufliche Entwicklungen zu überdenken.
Zwar spannen manche Anekdoten und Bezüge zeitweise den Bogen von der Mikro- hin zur Meso- und Metaebene, allerdings verliert man sich nicht in etwaigen Gedankensprüngen, sondern kann die entsprechenden Erklärungen und gegenseitigen Einflussfaktoren gut nachvollziehen, da sich beides zum Teil gegenseitig bedingt.
Das Ziel des Buchs, die persönliche, berufliche Entwicklung zu reflektieren sowie daraus hervorgehend Chancen und Grenzen auszuloten, wird erreicht, allerdings bleibt die Reflexion des beruflichen Selbstverständnisses oberflächlich, was aber auch durch die generalisierte Unklarheit in selbigem zu erklären ist. Trotz der teils rasanten, nichtsdestotrotz ausländischen Vorbildern um Jahrzehnte hinterherhinkenden, Entwicklung der teils selbsternannten Profession Pflege in Deutschland, bleibt weiterhin unklar, was den Kern pflegerischen Handelns ausmacht. Hierbei wird der Bogen zwischen dem Selbstverständnis als Arzt/Ärzt:inassisstenz bis hin zur selbsterschöpfenden und unerschöpflichen Ganzheitlichkeit gespannt, unklar bleibt allerdings nach wie vor die Frage „Was ist Pflege?“. Die Lösung liegt vermeintlich in der Thematik Vorbehaltsaufgaben bei welcher „die Pflege“ als eine Art Lotsenfunktion fungiert, unscharf bleibt hierbei trotz dessen, welche originären pflegerischen Grundlagenaufgaben dies beinhalten soll. Zwar bietet die Autorin mit dem Thememkomplex „Spiritual Care“ eine Möglichkeit an, allerdings kommt dies der ganzheitlichen Betrachtung und Behandlung des Individuums recht nah.
Das Buch ist aufgrund der Orientierung am historischen Zeitstrahl mitsamt den entsprechenden persönlichen, gesellschaftlichen und (berufs)politischen Entwicklungen übersichtlich gestaltet sowie nachvollziehbar gegliedert und behandelt aufgrund der weiterhin unablässigen Entwicklung im Gesundheitswesen ein äußerst aktuelles Thema. Es lohnt sich nicht nur deshalb, die vergangene vor dem Hintergrund der gegenwärtigen und zukünftigen Entfaltung der Pflege im Rahmen der Lektüre dieses Buchs zu reflektieren. Insgesamt fokussieren die Inhalte vor allem die Krankenpflege und das Krankenhaussetting, die Altenpflegesicht wird teilweise zu wenig adressiert. Auch wenn die Themen Vorbehaltsaufgaben und Verkammerung als mögliche Lösungen benannt werden, muss hierbei festgehalten werden, dass die Pflege in ihrer Gesamtheit wenig Bestrebungen zeigt, sich selbst der sogenannten Disziplinargesellschaft mit einer starken Fokussierung auf Selbstverwirklichung zuzuordnen. Es ist allerdings vor dem Hintergrund der jahrzehntelangen Ressourcenknappheit vollkommen legitim, wenn sich ein Gros des Berufs der passiveren Form der Leistungsgesellschaft zugehörig fühlt, bei der man eher als Empfänger:in von Anweisungen und Entwicklungen reagiert anstatt selbstverwirklichend zu agieren. Somit ist das Buch vor allem auch als Impuls aus Sicht des appellierenden und anpackenden Pioniergeistes anzusehen sowie hieraus hervorgehend, diesen bei der Lektüre (selbst)reflektierend zu nutzen.
Eine Rezension von Marco Sander,
B.A. Pflege und Gesundheitsförderung, M.A. Pflegewissenschaft -
Wechsel in der Bundesgeschäftsführung: Dr. Bernadette Klapper gibt Leitung des DBfK ab
![]() Nach nahezu vier Jahren als Bundesgeschäftsführerin wird Dr. Bernadette Klapper den Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) zum 31. August 2025 verlassen, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen.
Nach nahezu vier Jahren als Bundesgeschäftsführerin wird Dr. Bernadette Klapper den Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) zum 31. August 2025 verlassen, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen.Bernadette Klapper führt seit dem 1. Oktober 2021 die Geschäftsstelle des DBfK-Bundesverbands. Während ihrer Amtszeit etablierte sie den DBfK als wichtige Stimme der professionellen Pflege in zentralen gesundheitspolitischen Diskussionen. „Bernadette Klapper hat den Verband mit strategischem Blick und großem Engagement durch herausfordernde Jahre geführt“, sagt Vera Lux, Präsidentin des DBfK. „Ihr Einsatz für die Weiterentwicklung der Pflege – insbesondere im Bereich der kommunalen Gesundheitsversorgung – hat wichtige Impulse gesetzt.“
Dr. Bernadette Klapper vertrat den DBfK in zahlreichen Gremien, darunter in der Ratsversammlung des Deutschen Pflegerats sowie in der Fachberufekonferenz der Bundesärztekammer. Ihr zentrales Anliegen war es stets, die Profession Pflege zu stärken und aktiv an der Gestaltung neuer Versorgungsmodelle mitzuwirken. Besonders engagierte sie sich für die Einführung der Community Health Nurse und setzte sich für innovative Ansätze zur Weiterentwicklung der Langzeit- und ambulanten Pflege ein.
Mit ihrer ausgeprägten fachlichen Expertise und ihrem weitreichenden Netzwerk war Dr. Bernadette Klapper als Bundesgeschäftsführerin des DBfK eine geschätzte Ansprechpartnerin sowohl innerhalb der Pflegebranche als auch darüber hinaus.
Bis zur Neubesetzung der Position übernimmt der stellvertretende Geschäftsführer Peter Tackenberg kommissarisch die Leitung der Geschäftsführung.
Zur Pressemitteilung: https://www.dbfk.de/de/newsroom/pressemitteilungen/meldungen/2025/Wechsel-in-der-Bundesgeschaefts-fuehrung-des-DBfK.php
Foto: Dr. Bernadette Klapper (c) ïnes fotografie
-
Berufsstolz in der Pflege – Das Mutmachbuch
![]()
![]()
German Quernheim, Angelika Zegelin
Hogrefe Verlag, Bern, 3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage 2025, 376 Seiten, 40,00 €, ISBN 978-3-456-86364-1
Wenn ein Fachbuch im Pflegebereich bereits in der dritten Auflage erscheint, lässt das auf eine gewisse Resonanz und Relevanz schließen. „Berufsstolz in der Pflege“ von German Quernheim und Angelika Zegelin ist jedoch mehr als eine Reaktion auf den Bedarf – es ist ein Angebot. Ein Angebot an all jene, die in der Pflege tätig sind, sei es als Auszubildende, Fachperson, Lehrende oder Führungskraft, sich dem eigenen Beruf (wieder) anzunähern – mit einer Haltung der Wertschätzung, Reflexion und Selbstermächtigung.
Schon die äußere Struktur des Buches deutet darauf hin, dass es sich nicht um ein klassisches Fachbuch handelt. Vielmehr entfaltet es sich wie ein thematisch gegliederter Wegbegleiter, dessen detailliertes Inhaltsverzeichnis nicht nur Orientierung bietet, sondern auch einlädt: zum Nachschlagen, zum Blättern, zum gezielten Vertiefen. Wer das Buch liest, wird es kaum linear lesen – es funktioniert vielmehr wie ein Lexikon, ein Inspirationskatalog oder ein Werkzeugkasten. Und das mit Absicht.
Zegelin und Quernheim gelingt es, ein breites Spektrum an Themen aufzugreifen, die in klassischen Pflegefachbüchern oft unterrepräsentiert sind: berufsethische Fragestellungen, politische Positionierung, Identitätsbildung, aber auch Empathie, Sinn, Mut und Selbstwertgefühl. Dieses Buch ist kein Fachbuch im engeren Sinne – es ist ein Arbeitsbuch, das Haltung stärkt und Handlungsvorschläge anbietet.
Die dritte Auflage wurde vollständig überarbeitet und um aktuelle Themen erweitert: Berufsstolz bei international ausgebildeten Pflegekräften, neue rechtliche Entwicklungen in Deutschland und Österreich sowie ein „Update-Kapitel“, das mit Zitaten und Einblicken aus der Praxis sehr lebendig gestaltet ist. Eine Landkarte zum Berufsstolz, neue Adressen und weiterführende Literatur runden die Aktualisierung ab und zeigen, dass dieses Buch nicht in der Theorie verharrt, sondern in der pflegerischen Realität verankert ist.
Bemerkenswert ist die Offenheit, mit der sich die Autor*innen auch an die Gesellschaft und Politik wenden. Berufsstolz ist in diesem Buch kein individueller Luxus, sondern eine kollektive Aufgabe – denn Pflege kann ihre Rolle im Gesundheitssystem nur dann voll entfalten, wenn Pflegende sich ihrer Bedeutung bewusst sind und wenn Rahmenbedingungen dies ermöglichen. Das Buch argumentiert auf Augenhöhe, differenziert und mit Blick auf gesamtgesellschaftliche Verantwortung.
Was das Buch besonders lesenswert macht, ist seine Fähigkeit, theoretische Reflexion und praktische Impulse zu verbinden. Zahlreiche Aufgaben, Fragen und Fallbeispiele fordern zur aktiven Auseinandersetzung auf – nicht als Pflichtprogramm, sondern als Einladung. Leser*innen können entscheiden, wie tief sie einsteigen möchten. Die Aufgaben sind praxisnah und geeignet für den Einsatz in Fort- und Weiterbildung oder im Unterricht. Gerade in der pflegepädagogischen Arbeit bietet das Buch eine Vielzahl von Anknüpfungspunkten.
Die dargestellten Fallsituationen sind ein weiteres Highlight. Sie sind nicht nur illustrativ, sondern nehmen mehrere Seiten ein und erlauben es, sich wirklich in die Situationen hineinzudenken. Sie eignen sich hervorragend für Diskussionsanlässe in der Ausbildung, für Reflexionsphasen im Studium oder für Workshops mit Pflegeteams. Sie zeigen, wie vielschichtig berufliche Situationen sind – und wie Berufsstolz konkret gelebt (oder unterdrückt) werden kann.
Das Buch erhebt keinen Anspruch auf Neutralität – und das ist seine Stärke. Es ist ein Mutmachbuch, wie es im Titel steht. Es spricht aus einer Haltung heraus, die Pflege als zentrales gesellschaftliches Handlungsfeld ernst nimmt. Es will nicht objektiv distanziert analysieren, sondern berühren, motivieren, anregen. In dieser Hinsicht ist es ein sehr persönliches Buch – und lädt zur persönlichen Auseinandersetzung ein.
Dass es sich dennoch differenziert und theoretisch fundiert äußert, spricht für die Autor*innen. Beide sind in der Pflegewissenschaft und der beruflichen Bildung verwurzelt, was sich in der Tiefe der Themenwahl ebenso zeigt wie in der Sprache. Das Buch ist verständlich, aber nicht simpel. Es ist empathisch, aber nicht beliebig. Und es ist engagiert, ohne missionarisch zu sein.
Fazit:„Berufsstolz in der Pflege“ ist ein besonderes Buch. Es bietet keine schnellen Lösungen, aber viele gute Fragen. Es gibt keine fertigen Rezepte, aber zahlreiche Ideen, Impulse und ermutigende Beispiele. Wer in der Pflege arbeitet – ob am Bett, in der Lehre, in der Leitung oder auf pflegepolitischer Ebene – findet in diesem Buch einen kraftvollen Reflexionsraum. Und wer das Thema Berufsstolz bislang für weich, randständig oder entbehrlich hielt, wird hier eines Besseren belehrt. Eine klare Leseempfehlung für alle, die Pflege mit Haltung gestalten wollen.
Eine Rezension von Simon Ludwig-Pricha
-
Richtlinien für Qualitätsprüfungen in ambulanten Pflegediensten veröffentlicht
![]() Der Medizinische Dienst Bund hat Ende August neue Richtlinien für die Qualitätsprüfung in ambulanten Pflegediensten veröffentlicht. Sie wurden am 19. Mai 2025 erlassen, am 7. August 2025 vom Bundesministerium für Gesundheit genehmigt und treten zum 1. Juli 2026 in Kraft.
Der Medizinische Dienst Bund hat Ende August neue Richtlinien für die Qualitätsprüfung in ambulanten Pflegediensten veröffentlicht. Sie wurden am 19. Mai 2025 erlassen, am 7. August 2025 vom Bundesministerium für Gesundheit genehmigt und treten zum 1. Juli 2026 in Kraft.Die „Qualitätsprüfungs-Richtlinien ambulante Pflege Teil 1a – Ambulante Pflegedienste“ (QPR ambulante Pflege Teil 1a) bilden die Grundlage für die Qualitätsprüfung in der allgemeinen ambulanten Pflege, der außerklinischen Intensivpflege sowie der psychiatrischen häuslichen Krankenpflege, wie sie von ambulanten Pflegediensten erbracht werden. Außerdem regeln sie die Prüfung der Abrechnungen ambulanter Pflegedienste mit den gesetzlichen Kranken- und Pflegekassen. Die Qualitätsprüfung von ambulanten Betreuungsdiensten wird in einem eigenen Teil 1b der QPR ambulante Pflege festgelegt.
Die neue Prüfsystematik für ambulante Pflegedienste orientiert sich an der bereits in der vollstationären Pflege und der Tagespflege etablierten Prüfphilosophie, wurde jedoch speziell an die Besonderheiten der ambulanten Versorgung angepasst.
„Mit den neuen Qualitätsprüfungs-Richtlinien wird der Fokus noch stärker auf die Versorgungsqualität gerichtet. Neu ist beispielsweise, ob Pflegedienste eine drohende Überforderung von pflegenden Angehörigen im Blick haben und ansprechen, um die Pflegesituation stabil zu halten. Dies soll dazu beitragen, dass Pflegebedürftige möglichst lange in ihrer häuslichen Umgebung bleiben können. Zugleich verschlanken die neuen Richtlinien die zukünftigen Qualitätsprüfungen und fördern und stärken die Fachlichkeit der Pflegeeinrichtungen und der Prüfinstitutionen“, sagt Carola Engler, stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Medizinischen Dienstes Bund.
Im Mittelpunkt steht die Qualität, die bei der versorgten Person ankommt
Die Qualitätsprüfung rückt künftig noch stärker die Ergebnisqualität in den Mittelpunkt, während einrichtungsbezogene Strukturkriterien – mit wenigen Ausnahmen – nicht mehr prüfrelevant sein werden. So entfallen etwa Prüfaspekte zu Erste-Hilfe-Schulungen der Mitarbeitenden. Statt einer detaillierten Bewertung vieler Einzelkriterien werden die zentralen Themen nun anhand übergeordneter Qualitätsaspekte beurteilt.
Zur Beurteilung der Versorgungsqualität nimmt der Prüfdienst stichprobenartig Kontakt zu vom Pflegedienst betreuten Personen auf und führt Vor-Ort-Besuche durch. Die Auswahl erfolgt zufällig. In den Richtlinien ist festgelegt, wie viele Personen je nach Leistungsbereich – allgemeine ambulante Pflege, außerklinische Intensivpflege oder psychiatrische häusliche Krankenpflege – in die Prüfung einzubeziehen sind.
Zusammenfassende Bewertung eines Qualitätsaspekts anhand von Leitfragen
Der zukünftige Prüfkatalog orientiert sich an übergeordneten Qualitätsaspekten. Für jeden Aspekt erhebt das Prüfteam zunächst relevante Informationen. Diese werden mithilfe von Leitfragen ausgewertet, woraufhin eine zusammenfassende Einschätzung erfolgt. Die Ergebnisse werden in vier Bewertungskategorien eingeordnet:
- A Keine Auffälligkeiten oder Defizite
- B Auffälligkeiten, die keine Risiken oder negativen Folgen für die versorgte Person erwarten lassen
- C Defizit mit Risiko negativer Folgen
- D Defizit mit eingetretenen negativen Folgen.
Für die Darstellung der Qualität sind ausschließlich die Bewertungskategorien C und D relevant. Die konkreten Regeln für diese Qualitätsdarstellung werden zwischen den Kostenträgern und den Leistungserbringerverbänden vereinbart und treten gleichzeitig mit den Qualitätsprüfungs-Richtlinien in Kraft.
Beratungsorientierter Prüfansatz wird gestärkt
Die Richtlinien basieren weiterhin auf einen beratungsorientierten Prüfansatz. Dabei beraten die Prüferinnen und Prüfer die Pflegeeinrichtung und ihr Personal während der Prüfung zu möglichen Qualitätsverbesserungen. Neu ist, dass das Fachgespräch mit den Mitarbeitenden des Pflegedienstes künftig eine größere Rolle bei der Bewertung der individuellen Versorgungsqualität einnimmt.
Zur Sensibilisierung der Pflegedienste wurden Qualitätsaspekte aufgenommen, die ausschließlich beratenden Zwecken dienen. Sie behandeln unter anderem die Zusammenarbeit zwischen Pflegedienst und pflegenden Angehörigen sowie den Umgang mit Anzeichen von Gewalt, Vernachlässigung oder Unterversorgung der Pflegebedürftigen.
Hintergrund: Der Gesetzgeber hatte den Qualitätsausschuss Pflege beauftragt, durch wissenschaftliche Projekte neue Prüfverfahren sowie eine Alternative zur bisherigen Darstellung der Qualität von Pflegeeinrichtungen in Form von Pflegenoten zu entwickeln. Für die stationäre Pflege gibt es bereits seit 2019 ein neues Qualitätssystem. Nun liegt auch für die ambulante Pflege ein vergleichbares Qualitätssystem vor, das im Auftrag des Qualitätsausschusses Pflege von Wissenschaftlern der Hochschule Osnabrück (Prof. Dr. Andreas Büscher) sowie des Institutes für Pflegewissenschaft an der Uni Bielefeld (Prof. Dr. Klaus Wingenfeld) entwickelt und anschließend einem intensiven Evaluationsprozess unterzogen worden ist. Im Anschluss wurden die „Maßstäbe und Grundsätze für die Qualität und Qualitätssicherung sowie die Vereinbarung zur Qualitätsdarstellung in der ambulanten Pflege“ von den Vereinbarungspartnern (Verbände der Kostenträger und der Einrichtungsträger) überarbeitet. Die jetzt für die Qualitätsprüfung von ambulanten Pflegediensten nach 114a Absatz 7 SGB XI vorgelegten Richtlinien hat der Medizinische Dienst Bund auf Basis des wissenschaftlich entwickelten Prüfkonzeptes und der Maßstäbe und Grundsätze erstellt und erlassen. Die Qualitätsprüfungen werden vom Medizinischen Dienst und vom Verband der privaten Krankenversicherung durchgeführt.
Zur Pressemitteilung: https://md-bund.de/presse/pressemitteilungen/neueste-pressemitteilungen/richtlinien-fuer-qualitaetspruefungen-in-ambulan-ten-pflegediensten-veroeffentlicht.html
Foto: stock.adobe.com - goodluz
-
Kinderkrankenpflege in Frühen Hilfen: Zur Entstehung einer spezifischen Berufsausrichtung der Pflegefachberufe
![]()
![]() Birte Kimmerle
Birte KimmerleBeltz Juventa, Weinheim Basel 2025, 310 Seiten, 48,00 €, ISBN 978-3-7799-8695-9
Das Buch „Kinderkrankenpflege in Frühen Hilfen – Zur Entstehung einer spezifischen Berufsausrichtung der Pflegefachberufe“ von Birte Kimmerle widmet sich einem bisher wenig beachteten, aber hochrelevanten Thema: der Entstehung und Etablierung der Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflege (FGKiKP) im Kontext der Frühen Hilfen. Diese spezifische Berufsausrichtung hat sich in den vergangenen Jahren als wichtiger Baustein in der Prävention von Kindeswohlgefährdung etabliert, indem sie Familien und Kleinkinder in psychosozial belastenden Lebenssituationen unterstützt.
Birte Kimmerle, Ph. D., ist Gesundheits- und Pflegewissenschaftlerin, Dipl. Pflegewirtin (FH) und Kinderkrankenschwester. Momentan ist sie stellvertretende Referatsleitung „Pflege und Alter“ beim Kommunalverband Jugend und Soziales Baden-Württemberg und war zuvor wissenschaftliche Mitarbeiterin am Universitätsklinikum Tübingen. Ihre Interessenschwerpunkte umfassen familienorientierte Versorgungskonzepte, partizipative Versorgungsforschung, Praxisentwicklung und Professionalisierung der Pflegeberufe.
Es wurde unter dem Titel „Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflege in Frühen Hilfen: eine Arena-Analyse zur Entstehung einer spezifischen Berufsausrichtung der Pflegefachberufe“ 2024 die Dissertation von Birte Kimmerle zur Erlangung des Grades eines Philosophical Doctor (Ph. D.) an der Universität Witten/Herdecke, Fakultät für Gesundheit, Department für Pflegewissenschaft verfasst.
Das Buch gliedert sich in acht Kapitel, die von einer theoretischen und forschungsbezogenen Grundlegung über die methodologische Verortung bis hin zur empirischen Analyse und Diskussion der Ergebnisse reichen. Nach einer kurzen Einführung, wird der Forschungsstand zu zentralen Begrifflichkeiten und Konzepten aufgeführt. Hier wird der historische und politische Hintergrund von Frühen Hilfen skizziert sowie die besondere Rolle der Kinderkrankenpflege in diesem Setting erläutert. Außerdem wird die Theorie sozialer Welten und Arenen nach Strauss als Analysemittel professioneller Aushandlungsprozesse und Grundlage der Situationsanalyse beschrieben. Die Wahl für die Situationsanalyse nach Clarke, als Weiterentwicklung der Grounded Theory nach Glaser und Strauss, wird im methodologischen Teil begründet. Sie erlaubt es diskursive, historische und interaktive Dimensionen zusammenzuführen. Der empirische Teil gliedert sich in A) Rekonstruktion der Entwicklung Früher Hilfen und der Berufsrolle der FGKiKP und B) Analyse der Handlungspraxis und Positionierung der Fachkräfte im Feld. Abschließend werden die gewonnen Erkenntnisse diskutiert, Implikationen für Praxis, Bildung und Forschung abgeleitet und Limitationen sowie weiterer Forschungsbedarf aufgezeigt.
Das Vorgehen besticht durch den innovativen Zugang, professionstheoretische mit berufssoziologischen Perspektiven zu verbinden und die Situationsanalyse zu nutzen, um die komplexen und oft widersprüchlichen Prozesse der Berufsentwicklung nachzuzeichnen. Anders als vorherige Studien, die häufig entweder auf Familienhebammen oder auf strukturelle Aspekte der Frühen Hilfen fokussierten, wird die Kinderkrankenpflege ins Zentrum gerückt und zeigt, wie diese Berufsgruppe ihre Rolle in einem von Unsicherheit, Konkurrenz und Machtgefällen geprägten Feld aushandelt.
Kinderkrankenpflege in den Frühen Hilfe ist eine Doppelrolle: Einerseits ist sie Expertin für kindliche Gesundheit und Entwicklung, andererseits übernimmt sie eine Brückenfunktion zwischen dem Gesundheitssystem und der Kinder- und Jugendhilfe. Gerade in der Prävention von Kindeswohlgefährdung spielt sie eine essentielle Rolle, da sie durch langfristige, aufsuchende Arbeit frühzeitig Belastungen erkennen und niedrigschwellig unterstützen kann. Eine Herausforderung sind dabei die Arbeitsbedingungen bspw. prekäre Anstellungsverhältnisse mit Befristungen und stark variierende Vergütungen und Handlungsspielräume, welche sie zwingen entweder als „devote Handlangerin“ oder „gestaltende Einzelkämpferin“ zu agieren (Kimmerle 2025, 195).
Besonders aufschlussreich sind die Analysen zur Zusammenarbeit mit anderen Professionen wie Hebammen oder Sozialarbeiter*innen. Die Beziehung zwischen Familienhebammen und FGKiKP ist von einem Spannungsverhältnis zwischen Konkurrenz und Bereicherung geprägt. Während die Zuständigkeiten vordergründig klar erscheinen, kommt es in der Praxis häufig zu Überschneidungen und „Kompetenzgerangel“, weswegen klare Grenzen miteinander ausgehandelt werden müssen. Anders gestaltet es sich mit der Sozialen Arbeit, insb. mit der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH). Hier offenbaren sich unterschiedliche Fallverständnisse: FGKiKP fokussieren die Gesundheit, SPFH eher erzieherische und finanzielle Aspekte. Dies ist auch dem geschuldet, dass SPFH dem Jugendamt unterstellt sind, während FGKiKP das häufig nicht sind. FGKiKP befinden sich in dauerhaften Abgrenzungsprozessen von den Berufsgruppen, die schon länger in den Frühen Hilfen tätig sind. Um ein funktionierendes multiprofessionelles Netzwerk zu etablieren, braucht es Abstimmung und Austausch und ein gemeinsames Vorgehen ohne Konkurrenzdenken, sondern gegenseitiges Ergänzen und Verstehen. In diesen Netzwerken sehen sich FGKiKP aber „[…] oft nicht ernst genommen, nicht gehört oder unsichtbar“ (Kimmerle 2025, 204).
Das Ziel der Publikation, die Situation der FGKiKP im Arbeitsfeld Frühe Hilfen umfassend zu analysieren und daraus Entwicklungsimpulse abzuleiten, wird eindeutig erreicht. Es erfolgt nicht nur eine dichte Beschreibung, sondern auch eine kritische Einordnung der beruflichen Entwicklungsdynamiken. Die Ergebnisse (Kapitel 6) werden zu vielen weiteren Studien und bisherigen Erkenntnissen in Beziehung gesetzt. Für den Bildungskontext besonders interessant ist die Diskussion zur generalistischen Pflegeausbildung (2020), woraus sich die Frage ergibt, ob Kinderkrankenpflege sich zu einem spezifischen Tätigkeitsfeld der Pflegefachberufe entwickelt und welche Konsequenzen dies für FGKiKP hätte.
Die Übersichtlichkeit des Buches wird durch ein klares Kapiteldesign und ausführliche Abkürzungs-, Abbildungs- und Tabellenverzeichnisse unterstützt. Die grafischen Darstellungen, sowie Anlagen, sind ansprechend gestaltet und tragen zum Verständnis der komplexen Zusammenhänge bei. Auch der schriftliche Teil ist darauf ausgelegt verstanden zu werden, z. B. mit der Metapher des Fotografierens.
Kritisch anzumerken ist, dass die Fülle an theoretischen Konzepten und die komplexe Methodik die Lesbarkeit an manchen Stellen erschweren (Kapitel 3 und 4).Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Birte Kimmerle ein wichtiges, gut strukturiertes und theoretisch anspruchsvolles Buch vorgelegt hat, das die Diskussion um die Professionalisierung der Pflege in den Frühen Hilfen bereichert. Es ist lesenswert für Praktiker:innen in und außerhalb den Frühen Hilfen, also Pflegefachpersonen, Hebammen, Sozialpädagog:innen, Netzwerkkoordinator:innen und Verantwortliche in Jugend- und Gesundheitsämtern sowie Berufsverbände und Politik. Darüber hinaus bietet es wertvolle Impulse (Kapitel 7) für die Pflegebildung und Pflegewissenschaft hinsichtlich Professionalisierungs- und Versorgungsforschung. Es gelingt ihr, die Stimme einer bisher oft unsichtbaren Berufsgruppe hörbar zu machen und damit einen Beitrag zur Stärkung dieser im Netzwerk Frühe Hilfen und in ihrer Rolle im Kinderschutz und der Gesundheitsförderung zu leisten.
Eine Rezension von Nadja Körner
Pflegewissenschaft M.A., Pflegepädagogik B.A., Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin -
DBfK: Pflegegrad 1 muss bleiben und zielgerichteter ausgestaltet werden
![]() Die derzeitige Debatte über die Abschaffung des Pflegegrads 1 ist weder neu noch zielführend. Vielmehr bedarf es laut Deutschem Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) einer grundlegenden Neuausrichtung der Pflegeversicherung, inklusive einer Rückzahlung entnommener Gelder und der Herausnahme von Rentenansprüchen. Gleichzeitig wäre es sinnvoll, die Wirkungsabsicht des Pflegegrads 1 zu überprüfen und ihn stärker auf präventive Maßnahmen auszurichten.
Die derzeitige Debatte über die Abschaffung des Pflegegrads 1 ist weder neu noch zielführend. Vielmehr bedarf es laut Deutschem Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) einer grundlegenden Neuausrichtung der Pflegeversicherung, inklusive einer Rückzahlung entnommener Gelder und der Herausnahme von Rentenansprüchen. Gleichzeitig wäre es sinnvoll, die Wirkungsabsicht des Pflegegrads 1 zu überprüfen und ihn stärker auf präventive Maßnahmen auszurichten.„Die Ziele, mit denen der Pflegegrad 1 im Jahr 2017 eingeführt wurde, sind nach wie vor gut begründet“, betont Stefan Werner, Vizepräsident des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe (DBfK). „Dabei geht zum einen um einen längeren Verbleib in der eigenen Häuslichkeit und zum anderen um ein Hinauszögern einer stärkeren und damit auch wesentlich teureren Pflegebedürftigkeit durch präventive Maßnahmen. Diese Ziele jetzt kurzfristig für Einsparungen über Bord zu werfen, halten wir für besonders fahrlässig.“
Der DBfK fordert, versicherungsfremde Kosten konsequent in den Bundeshaushalt zu verlagern. Dazu zählen insbesondere die über 5 Milliarden Euro, die während der Corona-Pandemie entnommen wurden, sowie die Kosten für Rentenpunkte pflegender Angehöriger, die inzwischen rund 4 Milliarden Euro betragen.
Darüber hinaus plädiert der DBfK dafür, Prävention zur Priorität zu machen und die Kompetenz von Pflegefachpersonen stärker einzubinden. Sie können beraten, coachen sowie Angehörige schulen und begleiten. Auf diese Weise lassen sich frühzeitig drohende Überlastungen erkennen, Unterstützungsnetzwerke aktivieren und die Kontinuität der Versorgung sichern.„Der Pflegegrad 1 muss bleiben und den Zugang zu pflegefachlicher Leistung ermöglichen“, so Stefan Werner weiter. „Wir reden hier in erster Linie von älteren Pflegebedürftigen, das Durchschnittsalter bei der Antragstellung liegt bei fast 79 Jahren. Diese vulnerable Personengruppe können wir nicht unversorgt lassen. Sie bedarf in besonderem Maß einer zugehenden, aktiven Unterstützung, wie sie insbesondere Community Health Nurses (CHN) leisten können. Dafür sollten die Mittel in erster Linie verwendet werden, und wir sehen hier sowohl die Kommunen als auch die Pflegekassen in der Verantwortung. Wir als DBfK stehen für eine Überprüfung und daraus möglicherweise resultierende Neujustierung der Wirkungsabsicht des Pflegegrads 1 bereit, nicht aber für eine Abschaffung. Die Misere der Pflegeversicherung rührt nicht daher, dass Einzelne sie nicht in der intendierten Absicht nutzen. Sie muss vielmehr strukturell beseitigt werden.“
Zur Pressemitteilung: https://www.dbfk.de/de/newsroom/pressemitteilungen/meldungen/2025/2025-09-29-pflegegrad-1-muss-bleiben-und-zielgerichteter-ausgestaltet-werden.php
Foto: stock.adobe.com - rh2010
-
Neue ICN-Definitionen von Pflege: Verbände legen deutsche Übersetzung vor
![]() Was bedeutet es, eine Pflegefachperson zu sein? Wie lässt sich die Berufsgruppe definieren – und welche Bedeutung hat dies für das pflegerische Handeln, aber auch für Gesellschaft und Politik? Antworten auf diese Fragen gibt die neu gefasste Definition der Begriffe „Nurse“ und „Nursing“, die anlässlich des diesjährigen Kongresses des International Council of Nurses (ICN) veröffentlicht wurde. Die drei deutschsprachigen ICN-Mitgliedsverbände aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben nun eine gemeinsam erarbeitete, vom ICN autorisierte deutsche Übersetzung vorgelegt.
Was bedeutet es, eine Pflegefachperson zu sein? Wie lässt sich die Berufsgruppe definieren – und welche Bedeutung hat dies für das pflegerische Handeln, aber auch für Gesellschaft und Politik? Antworten auf diese Fragen gibt die neu gefasste Definition der Begriffe „Nurse“ und „Nursing“, die anlässlich des diesjährigen Kongresses des International Council of Nurses (ICN) veröffentlicht wurde. Die drei deutschsprachigen ICN-Mitgliedsverbände aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben nun eine gemeinsam erarbeitete, vom ICN autorisierte deutsche Übersetzung vorgelegt.„Die Definitionen beschreiben umfassend das Spektrum dessen, was professionelle Pflege heute leisten kann“, sagt Vera Lux, Präsidentin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe (DBfK), einer der drei beteiligten Verbände. „Damit geben wir beruflich Pflegenden eine Hilfestellung an die Hand, um ihre Rolle reflektieren und selbstbewusst ausüben zu können. Darum geht es im Kern: um eine Selbstbeschreibung, aber auch Selbstermächtigung.“
Die Versorgungsrealität, in der beruflich Pflegende tätig sind, hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Die Neudefinition greift diese Entwicklungen auf und bietet gleichzeitig eine Orientierung für die Politik, wie das Potenzial der professionellen Pflege in der Versorgung optimal genutzt werden kann. Darüber hinaus verdeutlichen die detaillierten Beschreibungen auch der Öffentlichkeit, welchen Beitrag Pflegefachpersonen in der ambulanten und stationären Gesundheitsversorgung leisten und welche Werte ihr Handeln prägen. Für die Pflegefachausbildung dienen die Definitionen zudem als Referenzpunkt neben den bestehenden Rahmenlehrplänen und Curricula.
Vera Lux betont, dass der DBfK sehr hoffe, dass mit der Neudefinition das volle Spektrum pflegerischer Kompetenz von den politisch Verantwortlichen, aber auch von der breiten Öffentlichkeit und Gesellschaft erkannt wird. Sie fügte hinzu: „Das könnte die Umsetzung in die heutige Versorgungsrealität in Deutschland befördern, auch vor dem Hintergrund, dass eine umfassende Reform der Versorgungsstrukturen in unserem Gesundheitssystem zwingend geboten ist und professionelle Pflege als relevanter Leistungserbringer anerkannt wird. Dazu braucht es eine inklusive Aufgabenverteilung unter den Gesundheitsprofessionen und mehr Autonomie für Pflegefachpersonen. Das Handbuch dafür liegt jetzt vor.“
Veranstaltungshinweis: Die Neuübersetzung wird in einem Webtalk am Donnerstag, dem 9. Oktober 2025, von 18 bis 20 Uhr der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt. Zur Anmeldung
Zur Pressemitteilung: https://www.dbfk.de/de/newsroom/pressemitteilungen/meldungen/2025/2025-10-06-nurse-und-nursing-jetzt-in-deutscher-uebersetzung.php
Foto: stock.adobe.com - Martin
-
Demenzpflege zu Hause: Neues Versorgungsmodell besteht Praxistest
![]() Pflegefachkräfte mit spezieller Zusatzqualifikation – sogenannte Dementia Care Manager – können die häusliche Versorgung von Menschen mit Demenz deutlich verbessern. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) in Zusammenarbeit mit Partnern aus Medizin und Gesundheitswesen. An der Untersuchung nahmen über 400 Menschen mit leichter bis mittelschwerer Demenz teil. Das Ergebnis: Die Betreuung durch Dementia Care Manager schloss Versorgungslücken deutlich wirksamer als die Standardversorgung und steigerte spürbar die Lebensqualität der Betroffenen.
Pflegefachkräfte mit spezieller Zusatzqualifikation – sogenannte Dementia Care Manager – können die häusliche Versorgung von Menschen mit Demenz deutlich verbessern. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) in Zusammenarbeit mit Partnern aus Medizin und Gesundheitswesen. An der Untersuchung nahmen über 400 Menschen mit leichter bis mittelschwerer Demenz teil. Das Ergebnis: Die Betreuung durch Dementia Care Manager schloss Versorgungslücken deutlich wirksamer als die Standardversorgung und steigerte spürbar die Lebensqualität der Betroffenen.Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), das höchste Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, empfiehlt die Einführung des Dementia Care Managements in die Regelversorgung. Entwickelt wurde das innovative Versorgungskonzept vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE).
Zu den Partnern des aktuellen Projekts zählen die Universitätsmedizin Greifswald, die Universitätsmedizin Rostock, die Techniker Krankenkasse, die AOK Nordost sowie mehrere regionale Ärzte- und Demenznetzwerke, darunter HaffNet Management GmbH, Demenz-Netzwerk Uckermark e.V., Gesundheitsnetz Frankfurt am Main eG (GNEF) und MEDIS Management GmbH.„Aufgrund der positiven Erfahrungen aus früheren Pilotprojekten wird das Dementia Care Management bereits von der medizinischen S3-Leitlinie für Demenzerkrankungen empfohlen. Zudem ist es Bestandteil der Nationalen Demenzstrategie“, erläutert Prof. Wolfgang Hoffmann, Versorgungsforscher am DZNE-Standort Rostock/Greifswald und Geschäftsführender Direktor des Instituts für „Community Medicine“ an der Universitätsmedizin Greifswald. „Das positive Votum aus dem G-BA gibt diesem Versorgungskonzept nun weiteren Rückenwind. Wir setzen uns sehr dafür ein, dass das Dementia Care Management in die Praxis kommt. Die Wirkung geht signifikant über die übliche Versorgung von Menschen mit Demenz hinaus. Außerdem stärkt das Dementia Care Management die Eigenverantwortung und Weiterentwicklung im Pflegeberuf und kann Hausärztinnen und Hausärzte wirksam entlasten.“
Die Universitätsmedizin Rostock – vertreten durch das Institut für Allgemeinmedizin – spielte eine zentrale Rolle im Bereich Schulung und Ausbildung. Im Mittelpunkt stand dabei die Entwicklung praxisorientierter Lehrfilme in Kombination mit einem begleitenden Kurzlehrbuch, das eigens verfasst wurde, um die kommunikativen Kompetenzen der Dementia Care Manager gezielt zu fördern und zu stärken.
„Uns war wichtig, die oft komplexe Kommunikation mit Menschen mit Demenz greifbar zu machen und Lehrmaterial zu schaffen, das sowohl fundiert als auch direkt in der Praxis anwendbar ist“, erklärt Dr. Anja Wollny, stellvertretende Leiterin des Instituts für Allgemeinmedizin an der Universitätsmedizin Rostock. „Mit den Lehrfilmen und dem Kurzlehrbuch geben wir den Fachkräften Werkzeuge an die Hand, um empathisch, zielgerichtet und professionell zu kommunizieren – eine Grundvoraussetzung für eine gelingende Versorgung.“
„Das Dementia Care Management zeigt, wie wir durch Innovationen das Leben von Menschen mit Demenz und ihren Familien verbessern können. Entscheidend ist dabei, dass Pflegepersonen mit erweiterten Kompetenzen eigenverantwortlich handeln und die verschiedenen Versorgungsbereiche miteinander verzahnen. Das entlastet die Hausärztinnen und Hausärzte. Außerdem sorgt es für mehr Qualität und Kontinuität in der häuslichen Betreuung“, betont Manon Austenat-Wied, Leiterin der TK-Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern.
„Als Krankenkasse verstehen wir uns als aktive Gestalterin der Versorgung. Innovationsfondsprojekte sind für uns eine wichtige Möglichkeit, unabhängig von finanziellen und rechtlichen Zwängen neue Versorgungsformen zu erproben und ihre Wirkung zu prüfen“, erläutert Waldemar Wiets, Leiter des Bereiches Gesundheitslandschaft bei der AOK Nordost. „Im Projekt InDePendent hat sich gezeigt: Eine bedarfsgerechte, von qualifizierten Pflegefachkräften gesteuerte Versorgung verbessert die Unterstützung von Demenzerkrankten spürbar. Die Behandlung war für die Krankenkassen zwar teurer als die normale Versorgung. Aus der Evaluation geht aber auch hervor, dass die Patientinnen und Patienten ein Plus an Lebensqualität gewinnen. Das Projekt war damit ein wichtiger Schritt in Richtung einer zukunftsfähigen Versorgung. Die Ergebnisse der Evaluation und die im Verlauf entwickelten Module fließen in die Weiterentwicklung unserer Versorgungsangebote mit ein.“
Die aktuelle Studie „InDePendent“ wurde vom Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) über den Innovationsfonds gefördert. Die Ergebnisse wurden im internationalen Fachjournal Alzheimer’s & Dementia veröffentlicht.
Weitere Informationen:
https://innovationsfonds.g-ba.de/beschluesse/independent.353 Beschluss des Innovationsausschusses beim G-BA
https://www.dzne.de/aktuelles/pressemitteilungen/presse/demenz-neues-modell-der-... Hintergrund zum Dementia Care Management
Zur Pressemitteilung: https://www.dzne.de/aktuelles/pressemitteilungen/presse/demenz-neues-modell-der-haeuslichen-versorgung-bewaehrt-sich-im-praxistest/
Foto: Dementia Care Managerin beim Hausbesuch. Quelle: DZNE / Kurda



 Pflegende Angehörige leisten im Verborgenen Großes: Etwa eine Million Menschen in Österreich versorgen ihre Angehörigen zu Hause. Die FH Kärnten und das Rote Kreuz Kärnten unterstützen sie mit praxisnahen Workshops und digitalen Lernangeboten. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben das Rote Kreuz Kärnten und die FH Kärnten eine praxisorientierte Workshopreihe ins Leben gerufen. Durch gezielte Schulungen sollen sie mehr Zeit und Lebensqualität gewinnen und ihre Aufgaben leichter bewältigen können.
Pflegende Angehörige leisten im Verborgenen Großes: Etwa eine Million Menschen in Österreich versorgen ihre Angehörigen zu Hause. Die FH Kärnten und das Rote Kreuz Kärnten unterstützen sie mit praxisnahen Workshops und digitalen Lernangeboten. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, haben das Rote Kreuz Kärnten und die FH Kärnten eine praxisorientierte Workshopreihe ins Leben gerufen. Durch gezielte Schulungen sollen sie mehr Zeit und Lebensqualität gewinnen und ihre Aufgaben leichter bewältigen können. Die Fachweiterbildung „Geriatrie und Gerontopsychiatrie“ erhält eine neue Rahmenvorgabe. Diese legt inhaltliche und qualitative Standards fest, die für die spezialisierte pflegerische Versorgung älterer und psychisch erkrankter Menschen von zentraler Bedeutung sind. Die Vorgabe wurde durch einen Unterausschuss des Bildungsausschusses der Pflegekammer NRW erarbeitet – nun sind Praxisexpertinnen und -experten aufgerufen, sich an der Weiterentwicklung zu beteiligen.
Die Fachweiterbildung „Geriatrie und Gerontopsychiatrie“ erhält eine neue Rahmenvorgabe. Diese legt inhaltliche und qualitative Standards fest, die für die spezialisierte pflegerische Versorgung älterer und psychisch erkrankter Menschen von zentraler Bedeutung sind. Die Vorgabe wurde durch einen Unterausschuss des Bildungsausschusses der Pflegekammer NRW erarbeitet – nun sind Praxisexpertinnen und -experten aufgerufen, sich an der Weiterentwicklung zu beteiligen. Der AltenpflegePreis 2025 würdigt innovative Konzepte, die eine hohe Pflegequalität auch in Zeiten von Fachkräftemangel und neuen Arbeitsorganisationen sicherstellen. Ziel des Preises ist es, herausragende Ansätze in der Altenpflege auf einer bundesweiten Plattform zu präsentieren und so den Austausch sowie die Weiterentwicklung in der Branche zu fördern. Der renommierte Preis ehrt Konzepte, die das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner konsequent in den Mittelpunkt stellen.
Der AltenpflegePreis 2025 würdigt innovative Konzepte, die eine hohe Pflegequalität auch in Zeiten von Fachkräftemangel und neuen Arbeitsorganisationen sicherstellen. Ziel des Preises ist es, herausragende Ansätze in der Altenpflege auf einer bundesweiten Plattform zu präsentieren und so den Austausch sowie die Weiterentwicklung in der Branche zu fördern. Der renommierte Preis ehrt Konzepte, die das Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner konsequent in den Mittelpunkt stellen.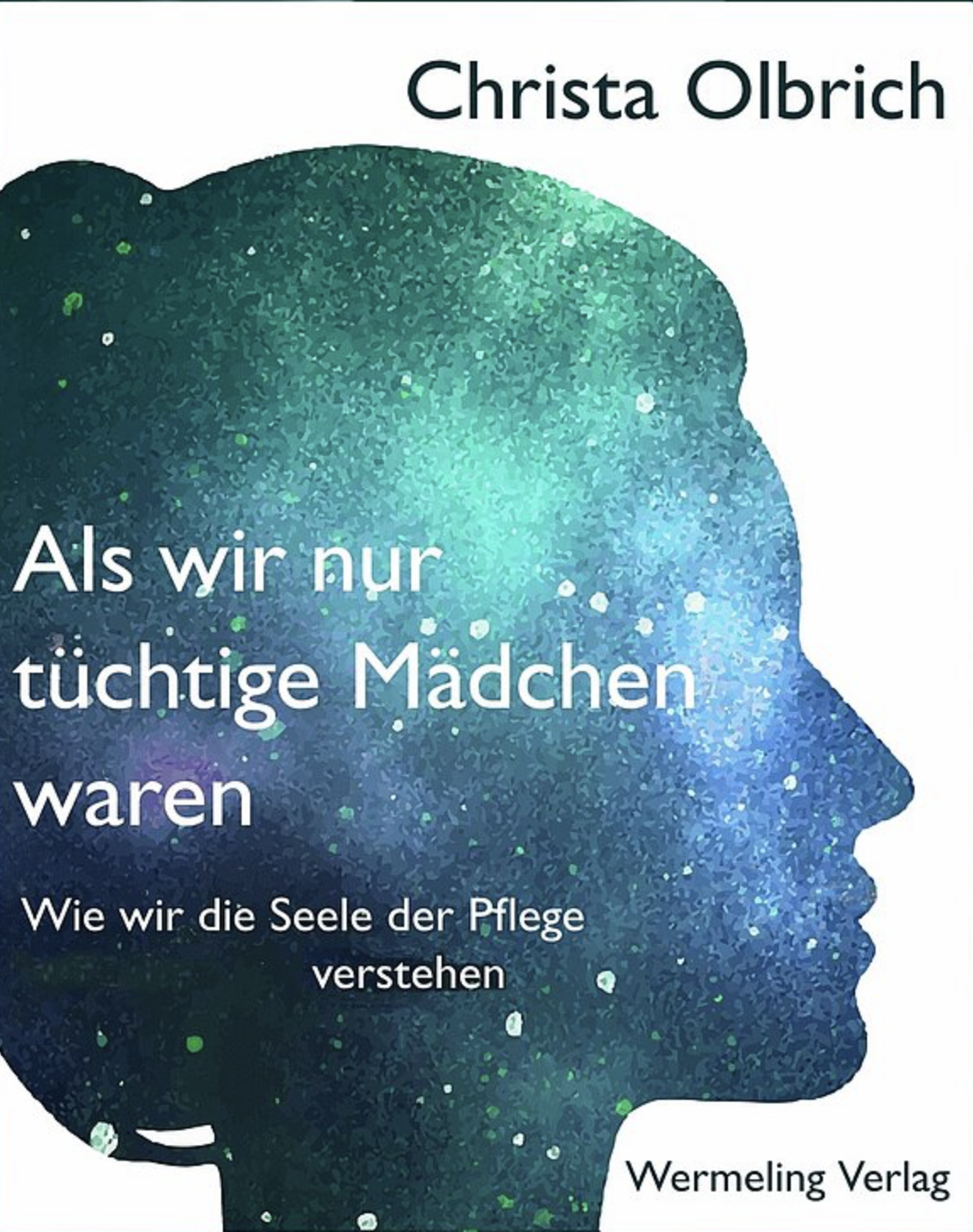
 Nach nahezu vier Jahren als Bundesgeschäftsführerin wird Dr. Bernadette Klapper den Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) zum 31. August 2025 verlassen, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen.
Nach nahezu vier Jahren als Bundesgeschäftsführerin wird Dr. Bernadette Klapper den Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) zum 31. August 2025 verlassen, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen.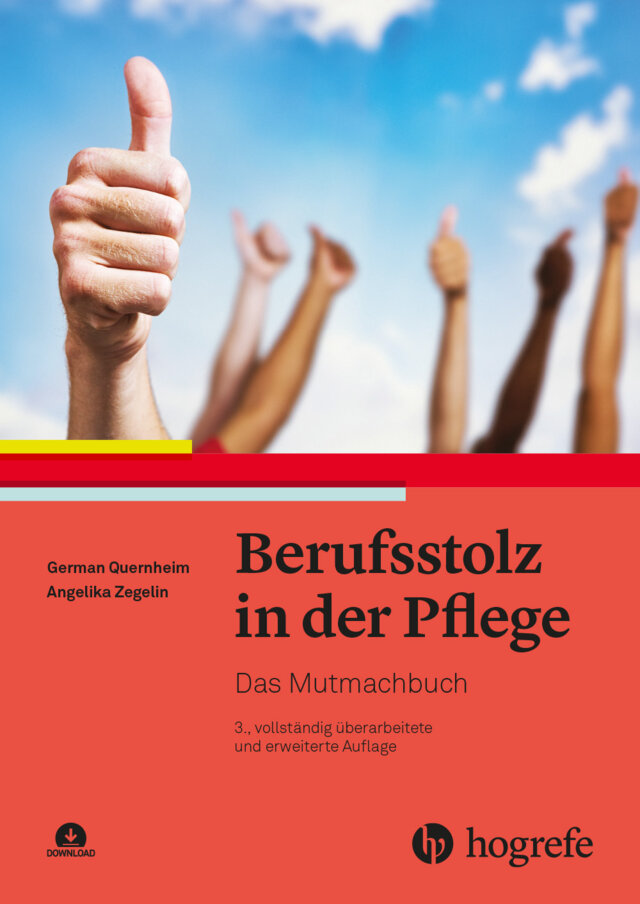
 Der Medizinische Dienst Bund hat Ende August neue Richtlinien für die Qualitätsprüfung in ambulanten Pflegediensten veröffentlicht. Sie wurden am 19. Mai 2025 erlassen, am 7. August 2025 vom Bundesministerium für Gesundheit genehmigt und treten zum 1. Juli 2026 in Kraft.
Der Medizinische Dienst Bund hat Ende August neue Richtlinien für die Qualitätsprüfung in ambulanten Pflegediensten veröffentlicht. Sie wurden am 19. Mai 2025 erlassen, am 7. August 2025 vom Bundesministerium für Gesundheit genehmigt und treten zum 1. Juli 2026 in Kraft.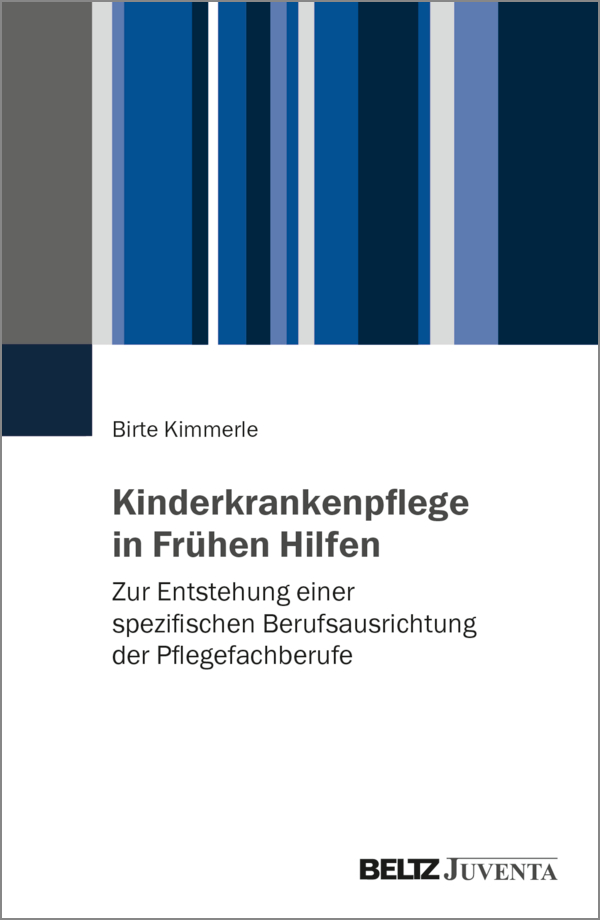
 Die derzeitige Debatte über die Abschaffung des Pflegegrads 1 ist weder neu noch zielführend. Vielmehr bedarf es laut Deutschem Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) einer grundlegenden Neuausrichtung der Pflegeversicherung, inklusive einer Rückzahlung entnommener Gelder und der Herausnahme von Rentenansprüchen. Gleichzeitig wäre es sinnvoll, die Wirkungsabsicht des Pflegegrads 1 zu überprüfen und ihn stärker auf präventive Maßnahmen auszurichten.
Die derzeitige Debatte über die Abschaffung des Pflegegrads 1 ist weder neu noch zielführend. Vielmehr bedarf es laut Deutschem Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) einer grundlegenden Neuausrichtung der Pflegeversicherung, inklusive einer Rückzahlung entnommener Gelder und der Herausnahme von Rentenansprüchen. Gleichzeitig wäre es sinnvoll, die Wirkungsabsicht des Pflegegrads 1 zu überprüfen und ihn stärker auf präventive Maßnahmen auszurichten. Was bedeutet es, eine Pflegefachperson zu sein? Wie lässt sich die Berufsgruppe definieren – und welche Bedeutung hat dies für das pflegerische Handeln, aber auch für Gesellschaft und Politik? Antworten auf diese Fragen gibt die neu gefasste Definition der Begriffe „Nurse“ und „Nursing“, die anlässlich des diesjährigen Kongresses des International Council of Nurses (ICN) veröffentlicht wurde. Die drei deutschsprachigen ICN-Mitgliedsverbände aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben nun eine gemeinsam erarbeitete, vom ICN autorisierte deutsche Übersetzung vorgelegt.
Was bedeutet es, eine Pflegefachperson zu sein? Wie lässt sich die Berufsgruppe definieren – und welche Bedeutung hat dies für das pflegerische Handeln, aber auch für Gesellschaft und Politik? Antworten auf diese Fragen gibt die neu gefasste Definition der Begriffe „Nurse“ und „Nursing“, die anlässlich des diesjährigen Kongresses des International Council of Nurses (ICN) veröffentlicht wurde. Die drei deutschsprachigen ICN-Mitgliedsverbände aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben nun eine gemeinsam erarbeitete, vom ICN autorisierte deutsche Übersetzung vorgelegt. Pflegefachkräfte mit spezieller Zusatzqualifikation – sogenannte Dementia Care Manager – können die häusliche Versorgung von Menschen mit Demenz deutlich verbessern. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) in Zusammenarbeit mit Partnern aus Medizin und Gesundheitswesen. An der Untersuchung nahmen über 400 Menschen mit leichter bis mittelschwerer Demenz teil. Das Ergebnis: Die Betreuung durch Dementia Care Manager schloss Versorgungslücken deutlich wirksamer als die Standardversorgung und steigerte spürbar die Lebensqualität der Betroffenen.
Pflegefachkräfte mit spezieller Zusatzqualifikation – sogenannte Dementia Care Manager – können die häusliche Versorgung von Menschen mit Demenz deutlich verbessern. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) in Zusammenarbeit mit Partnern aus Medizin und Gesundheitswesen. An der Untersuchung nahmen über 400 Menschen mit leichter bis mittelschwerer Demenz teil. Das Ergebnis: Die Betreuung durch Dementia Care Manager schloss Versorgungslücken deutlich wirksamer als die Standardversorgung und steigerte spürbar die Lebensqualität der Betroffenen.